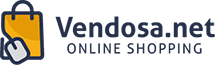Agb für Shop
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den ShopBei Gesetzestexten wie AGB, Widerrufsbelehrung und Co. können vielfältige Irrtümer auftreten, die zu Mißverständnissen mit dem Auftraggeber oder zu einer Verwarnung fÃ?hren können. Damit dies nicht passiert, sollten Sie immer die aktuellen Gesetzestexte auf Ihren Websites verwenden. Die juristischen Texte werden von auf IT-Recht spezialisierten Rechtsanwälten - sowohl für Ihren Online-Shop als auch für Ihr Unternehmen auf über 50 Vertriebsplattformen - aufbereitet.
Im Online-Handel bekommen Sie von uns individuell vereinbarte Konditionen zur rechtlichen Absicherung. Mit der Datenschutzerklärung sorgen Sie für Übersichtlichkeit und Datensicherheit in Ihrem Online-Shop. Unterrichten Sie Ihre Kundinnen und Kunden über das vorhandene Widerspruchsrecht mit der jeweils gültigen Widerrufsbelehrung. Es handelt sich um eine freiwillig gewährte Solidaritätsleistung für die Versicherten.
Öffnen Sie einen Online-Shop: Welche gesetzlichen Bestimmungen sind zu befolgen?
Viele Shopbetreiber sehen sich bei den Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) mit einigen großen Fragen konfrontiert: Die AGB sind - im Allgemeinen - der gesetzliche Bezugsrahmen für Aufträge. Diese sollen den Vertragsabschluss und die Vertragsabwicklung vereinfachen. Anders als bei Einzelverträgen werden die Allgemeinen Bedingungen vom Nutzer vorformuliert und für eine Reihe von Aufträgen verwendet.
In diesem Fall ist die Untergrenze für die Übernahme der Eigenschaft des "Plural" drei bis fünfmalig. Prinzipiell bleibt es jedem Shopbetreiber überlassen, ob er die AGB in seinem Online-Shop nutzen möchte oder nicht. Wenn keine AGB angewendet werden, richtet sich das Rechtsverhältnis zwischen den Vertragsparteien nach dem Recht, in der Regel nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.
Shopbetreiber haben jedoch die Mýglichkeit, die rechtlichen Bestimmungen zu ihren Gunsten zu ýndern. Hinweis: Einzeln verhandelte Aufträge und Vertragskonditionen haben immer Priorität vor den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (§ 305b BGB) aufgrund privater Autonomie. Wenn Sie dem Besteller z.B. per E-Mail eine gewisse Gewähr zusichern, geht es dabei prinzipiell um eine individuelle Vereinbarung, die eine hiervon abweichende AGB-Regelung ersetzt.
Shopbetreiber, deren Waren- und Leistungsangebot sich auch an Konsumenten wendet, also an diejenigen, die im B2C-Bereich aktiv sind, müssen daher in der Regel ihrer Informationspflicht nachkommen. Angaben zu den für den Vertragsabschluss zur Auswahl stehen. Es besteht daher mittelbar eine Verpflichtung zur Nutzung der AGB, und zwar dann, wenn Shopbetreiber (auch) an Privatkunden veräußern.
In ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen wenden Unternehmen oft Wahlklauseln an, mit denen sie bei Vertragsabschlüssen mit in- und ausländischen Konsumenten das für das jeweilige Rechtsverhältnis bekannteste inländische Recht bestimmen (sog. Vertragsstatut), oder sie entscheiden sich für das Recht eines Bundesstaates als Vertragsrecht, das ihnen die für das Rechtsverhältnis mit dem Verbraucher vorteilhaftesten Vertragskonditionen anbietet.
Der BGH (Urteil vom 19. Juli 2012, I ZR 40/11) hielt folgende Bestimmung für unzulässig und damit unwirksam: "Anwendbares Recht/Gerichtsstand: Für alle Streitigkeiten und Rechtsstreite im Rahmen der Geschäftsverbindung findet ausschliesslich das niederländische Recht unter Ausschluß des UN-Kaufrechts Anwendung" Nach Ansicht des BGH bringt diese Rechtswahlklausel dem Konsumenten einen unzumutbaren Nachteil, weil sie nicht eindeutig und nachvollziehbar ist.
Die Bestimmung nach 307 Abs. 1 BGB ist daher ungültig. Hier ein Beispiel: Diese Bestimmung ist aus mehreren Gruenden verwundbar. Am wichtigsten ist jedoch, dass solche Bestimmungen gegenüber einem Konsumenten (gemäß 309 Nr. 5 BGB) nur gelten, wenn dem Gegenüber ausdrücklich der Beweis erlaubt ist, dass ein solcher überhaupt kein oder ein geringerer Wert als die Pauschalierung eintritt.
Die Bestimmung schließt auch das Recht des Verbrauchers aus, die Abnahme z.B. wegen Mängeln zu versagen und sie dann auf Rechnung des Käufers zurückzusenden. Außerdem ein Klauselbeispiel: Diese Bestimmung ist ungültig, da die Gewährleistungsansprüche der Konsumenten in groben Zügen unzulässigerweise eingeschränkt sind, siehe § 308 Nr. 8 b, aa BGB.
Eine Regelung, nach der auch eine Teillieferung möglich ist, ist ungültig. Anderslautende Bestimmungen gelten nur, wenn sie für den Auftraggeber angemessen sind und das Kriterium der Angemessenheit explizit angegeben ist. Für den Kauf von Konsumgütern gelten die §§ 475ff. Veräußert ein Unternehmen eine bewegte Sache an einen Konsumenten, ist eine Verjährung der Sachmängelhaftung gemäß 475 BGB ausgenommen.
Nur die Haftungsbeschränkung für Gebrauchtwaren kann auf ein Jahr nach § 475 BGB gem. Im Übrigen findet 309 Nr. 8 b) BGB Anwendung auf die Begrenzung von Mängeln. schließt die Pflicht des Verkäufers zur Übernahme der zum Zweck der Nacherfüllung notwendigen Kosten, namentlich Transport-, Wege-, Arbeits- und Sachkosten aus oder begrenzt sie; macht die Nacherfüllung unter Berücksichtigung des Fehlers von der Vorauszahlung der vollen Vergütung oder eines unverhältnismäßigen Teiles der Vergütung ab; bestimmt dem Besteller eine Verjährungsfrist für die Rüge nicht offenkundiger Sachmängel von weniger als einem Jahr; begrenzt die Verjährungsfrist für Ansprüche gegen den Veräußerer wegen eines Sachmangels auf weniger als ein Jahr.
Ist ein Konsumgüterkauf (Unternehmer veräußert an Consumer Mobile Sache) vorhanden, kann die Zweijahresfrist für Mängeln weder in AGB noch in Einzelverträgen effektiv gekürzt werden. Die folgende Bestimmung der AGB ist aus den angeführten GrÃ?nden ungÃ?ltig: Seit dem 24. Februar 2016 ist das neue "Gesetz zur Besserung des Zivilrechts der Verbraucherschutzbestimmungen des Datenschutzrechts" in Kraft und verlangt die Ãnderung der AGB mit der Schriftform ab dem 1. Oktober 2016.
Künftig ist das Schriftformerfordernis nur noch bei notariell beurkundeten Verträgen zulässig. Es reicht nicht aus, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzunehmen, wenn sie erst nach längerer Suche auf der Website des Shopbetreibers zu finden sind. Eine solche versteckte oder unklare Bezugnahme kann dazu fÃ?hren, dass die AGB im Zweifelsfall nicht aufgenommen werden und somit die - fÃ?r den Shopbetreiber oft weniger gÃ?nstigen - Bestimmungen des BGB zur Anwendung kommen.
Die Aufnahme von AGB in den Auftrag bedarf daher eines expliziten Hinweises auf die AGB. Dies muss im direkten Raumzusammenhang mit dem Bestellschein erfolgen und für den Auftraggeber klar zum Ausdruck gebracht werden, wie er die AGB betrachten kann. Der sicherste Weg, sie einzubeziehen, ist, den Käufer vor Ausführung der Lieferung mit den AGB zu kontaktieren.
Das kann dadurch gewährleistet werden, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Besteller vor der Auftragserteilung immer zur Kenntnis gebracht werden und auch die Bestätigung, z.B. durch Ankreuzen, erfolgen muss. Für alle Online-Shops gibt es keine übereinstimmenden Bedingungen. Zuerst sollten Sie sich die Frage stellen, ob sich Ihr Gebot (auch) an Privatpersonen wendet.
Der Shopbetreiber im B2C-Bereich unterliegt nämlich, wie bereits beschrieben, zahlreichen Informations- und Unterweisungspflichten, die er (teilweise) durch Allgemeine Geschäftsbedingungen erfüllen kann. Im Rahmen der Bedingungen eines Online-Shops, dessen Angebot sich auch an Privatpersonen wendet, sollten daher unter anderem folgende Aspekte regelm? Wenn sich Ihr Angebot (auch) an Privatpersonen wendet, sollten Sie bei der Gestaltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen risikobehaftete Bestimmungen vermeiden oder zumindest von einem Fachanwalt prüfen lassen.
In den Shop-AGB werden die für den Online-Handel relevanten Bestimmungen wie z.B. die Verbraucherrechtsrichtlinie der Europäischen Union sowie die entsprechenden Bestimmungen des BGB und des EGBGB berücksichtigt. Darüber hinaus sind die AGB mit folgenden für den Online-Handel besonders praxisrelevanten Sachverhalten vertraut: Speditionslieferungen "frei Haus", Vorbehalt bei Vorausleistungspflicht des Auftragnehmers, Begrenzung der Sachmängelhaftung - z.B. für Gebrauchtwaren, Einigung des Kaufrechtes bei Kaufverträgen mit ausl.
E-Books, Video-Dateien (außer Software), Kauf und Rücknahme von Gutscheinen, Rücknahme von Werbegutscheinen, Widerrufsrecht für Konsumenten aus Nicht-EU-Mitgliedsstaaten, Freistellung von der Haftung bei Rechtsverletzungen Dritter (individualisierbare Produkte), Dauerlieferverträge (Abonnementverträge).