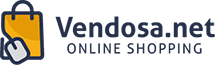Widerrufsrecht Onlineshop
Rücktrittsrecht Online-Shop1.2 Benötigt jeder Online-Shop allgemeine Geschäftsbedingungen? Prinzipiell bleibt es jedem Shopbetreiber überlassen, ob er die AGB in seinem Online-Shop nutzen möchte oder nicht. Shopbetreiber haben jedoch die Mýglichkeit, die rechtlichen Bestimmungen zu ihren Gunsten zu ýndern. Shopbetreiber, deren Waren- und Leistungsangebot sich auch an Konsumenten wendet, also an diejenigen, die im B2C-Bereich aktiv sind, müssen daher in der Regel ihrer Informationspflicht nachkommen.
Es besteht daher mittelbar eine Verpflichtung zur Nutzung der AGB, und zwar dann, wenn Shopbetreiber (auch) an Privatkunden veräußern. Im Folgenden wollen wir Ihnen eine erste Orientierung bieten, die - oft in Online-Shops eingesetzt - ein großes Warnrisiko birgt. In ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen wenden Unternehmen oft Wahlklauseln an, mit denen sie das für das jeweilige Rechtsverhältnis am besten anerkannte nationale Recht (sog. Vertragsstatut) in Verbraucherverträgen im In- und Ausland bestimmen, oder sie entscheiden sich für das Recht eines Bundesstaates als Vertragsrecht, das ihnen die für das Rechtsverhältnis mit dem Verbraucher vorteilhaftesten Vertragskonditionen anbietet.
Der BGH (Urteil vom 19. Juli 2012, I ZR 40/11) hielt folgende Bestimmung für unzulässig und damit unwirksam: "Anwendbares Recht/Gerichtsbarkeit: Nach Ansicht des BGH bringt diese Rechtswahlklausel den Verbrauchern einen unzumutbaren Nachteil entgegen den Grundsätzen von Treu und Glauben, da sie nicht eindeutig und nachvollziehbar sei. Selbst bei pauschalen Schadenersatzansprüchen sollten Online-Händler vorsichtig sein.
Am wichtigsten ist jedoch, dass solche Bestimmungen gegenüber einem Konsumenten (gemäß 309 Nr. 5 BGB) nur gelten, wenn dem Gegenüber ausdrücklich der Beweis erlaubt ist, dass ein solcher überhaupt kein oder ein geringerer Wert als die Pauschalierung eintritt. Die Bestimmung schließt auch das Recht des Verbrauchers aus, die Abnahme z.B. wegen Mängeln zu versagen und sie dann auf Rechnung des Käufers zurückzusenden.
Außerdem ein Klauselbeispiel: Diese Bestimmung ist ungültig, da die Gewährleistungsansprüche der Konsumenten in groben Zügen unzulässigerweise eingeschränkt sind, siehe § 308 Nr. 8 b, aa BGB. Veräußert ein Unternehmen eine bewegte Sache an einen Konsumenten, ist eine Verjährung der Sachmängelhaftung gemäß 475 BGB ausgenommen. Besteht ein Konsumgüterkauf (Unternehmer veräußert bewegliches Gut an Verbraucher), kann die Zweijahresfrist für Sachmängel weder in Allgemeinen Geschäftsbedingungen noch in Einzelverträgen effektiv gekürzt werden.
Auf diesen Beitrag weisen wir Sie gern hin. der dem anderen Vertragspartner die Gelegenheit gibt, seinen Text zur Kenntniszunehmen. Eine solche versteckte oder unklare Bezugnahme kann dazu fÃ?hren, dass die AGB im Zweifelsfall nicht aufgenommen werden und somit die - fÃ?r den Shopbetreiber oft weniger gÃ?nstigen - Bestimmungen des BGB zur Anwendung kommen.
Das kann dadurch gewährleistet werden, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Besteller vor der Auftragserteilung immer zur Kenntnis gebracht werden und auch die Bestätigung, z.B. durch Ankreuzen, erfolgen muss. Es besteht auch die Moeglichkeit, das Versenden der Bestellungen davon abhaengig zu machen, dass die GTC durchlaufen wird. Für alle Online-Shops gibt es keine übereinstimmenden Bedingungen.
Der Shopbetreiber im B2C-Bereich unterliegt nämlich, wie bereits beschrieben, zahlreichen Informations- und Unterweisungspflichten, die er (teilweise) durch Allgemeine Geschäftsbedingungen erfüllen kann. Im Rahmen der Bedingungen eines Online-Shops, dessen Angebot sich auch an Privatpersonen richtet, sollten daher unter anderem folgende Aspekte regelm? Unter keinen Umständen sollten Sie die Geschäftsbedingungen Dritter annehmen oder nachahmen.
Zum einen entsprechen die übernommenen Bedingungen in den meisten FÃ?llen nicht dem Begriff Ihres Online-Shops und zum anderen garantieren die übernommenen Bedingungen nicht deren rechtliche Eindeutigkeit. IT-Recht Rechtsanwälte offerieren Einzelhändlern, die Waren über ihren eigenen Online-Shop verkaufen, geeignete Gesetzestexte, die vor Zahlungserinnerungen geschützt sind. Dabei werden die für den Online-Handel relevanten Bestimmungen wie z.B. die Verbraucherrechtsrichtlinie der Europäischen Union sowie die entsprechenden Bestimmungen des BGB und des EGBGB berücksichtigt.
Die AGB regeln darüber hinaus folgende für den Online-Handel besonders relevante Sachverhalte: E-Books, Video-Dateien (außer Software), Kauf und Rücknahme von Gutscheinen, Rücknahme von Gutscheinen, Ausschluß des Widerrufsrechtes für Konsumenten aus Nicht-EU-Staaten, Freistellung von der Haftung bei Schutzrechtsverletzungen (individualisierbare Produkte), Dauerlieferungsverträge (Abonnementverträge). Sofern ein Käufer einen Gegenstand im Netz geordert hat, steht ihm in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu.
Mit dem Widerrufsrecht im Versandhandel sollen die Benachteiligungen gegenüber dem Stationärhandel ausgeglichen und der Konsument in die Lage versetzt werden, die von ihm bestellten Waren einer "Prüfung" zu unterziehen und zu beurteilen, ob er sie zurückschicken oder aufbewahren will. Der Shop-Betreiber ist verpflichtet, den Konsumenten über das Widerrufsrecht detailliert zu unterrichten.
Diese Verpflichtung kann am besten durch eine im Online-Shop durchgeführte rechtssichere und hinreichende Widerrufserklärung erfüllt werden. Ein fehlender oder unzureichender Widerruf ist ein klassischer Hinweis im Mahneland! Ein fehlender oder unzureichender Widerruf ist ein klassischer Hinweis im Lande der Mahner. Aber in welchen Faellen muessen die Ladenbetreiber besonders aufpassen?
Im schlimmsten Fall entfällt natürlich die Widerspruchsbelehrung im Online-Shop. Die Nichtberücksichtigung des gesetzlich verankerten Widerrufsrechtes kann dazu fuehren, dass der Konsument sein Widerrufsrecht nicht ausuebt. Es hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Veränderungen gegeben, insbesondere im Hinblick auf das Widerrufsrecht. In jüngster Zeit, im Jahr 2014, hat der gesetzgebende Organismus mit dem "Gesetz zur Durchführung der Verbraucherschutzrichtlinie und zur Novellierung des Wohnungsunternehmensgesetzes " eine Vielzahl neuer Vorschriften in das Widerrufsrecht aufgenommen.
Durch die ständigen Veränderungen des Widerrufsrechtes kann es vorkommen, dass man eine Innovation einfach nicht bemerkt und vergißt, seine Belehrung auf den neuesten Stand zurueckzubringen. Seit dem 13. Juni 2014 muss z.B. die Rufnummer in der Stornierungspolitik vermerkt sein. Sollte die Rufnummer in der Widerspruchsbelehrung fehlen, ist diese nicht ausreichend und kann verwarnt werden (vgl. dazu OLG Hamm, Beschluss vom 24.03.2015, 4 U 30/15).
Seit dem 13.06.2014 ist auch die Information des Händlers über den Anfang der Rücktrittsfrist zu erteilen. Es genügt nicht, mehrere für den Fristenbeginn maßgebliche Abweichungen aus dem Rechtsmodell einfach Seite an Seite in die Belehrung über den Widerruf zu kopieren. Es ist nicht nötig, dass der Konsument selbst "rätselt", welche der Termine für ihn gilt.
Der Widerruf ist auch in diesem Falle nicht ausreichend und kann gewarnt werden (siehe dazu LG Frankfurt a. M. Resolution vom 21.05.2015, 2-06 O 203/15). Kaufleute sollten daher auf der sicheren Seite sein und rechtlich abgesicherte Widerrufsbelehrungen erteilen, sobald der Online-Shop freigeschaltet wird. 2.3 Wann muss in einem Online-Shop eine Stornierungspolitik erfolgen, die ausschließlich im Wege der Fernkommunikation erfolgt.
"Fernabsatzkommunikationsmittel " jedes Mittel der Kommunikation, das zur Einleitung oder zum Abschluß eines Vertrages zwischen einem Konsumenten und einem Unternehmen ohne gleichzeitiges physisches Erscheinen der Vertragspartner verwendet werden kann. Für Shopbetreiber bedeutet dies: Bestellt der Konsument einen Gegenstand in einem Online-Shop, steht ihm das Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu. Shopbetreiber, deren Angebot sich daher (auch) an Konsumenten wendet, d.h. die im B2C-Bereich aktiv sind, müssen daher generell Anweisungen zum Widerruf geben.
Allerdings sehen die Gesetze eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen zur Vergabe eines gesetzlich verankerten Ausschlussrechts vor. Insbesondere folgende Bestimmungen sind für Online-Händler relevant: Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, gilt das Widerrufsrecht nicht für Verträge über die Auslieferung von Waren, die nicht konfektioniert sind und für deren Anfertigung eine persönliche Wahl oder der Bestimmungsort durch den Konsumenten entscheidend ist oder die klar auf die individuellen Wünsche des Konsumenten abgestimmt sind.
Auch bei Verträgen über die Auslieferung von Waren, die rasch verdorben werden können oder deren Verfalldatum rasch verstrichen wäre, gilt das Widerrufsrecht nicht. Zum Beispiel sind Nahrungsmittel oder Blumen nicht durch das gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsrecht abgedeckt. 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB verweigert ein Rücktrittsrecht bei Verträgen über die Auslieferung von versiegelten Waren, die aus gesundheitlichen oder hygienischen Gesichtspunkten nicht zur Rücksendung geeignet sind, wenn deren Verschließung nach der Auslieferung aufgehoben wurde.
Bei Verträgen über die Überlassung von Ton- oder Videoaufzeichnungen oder von Computerprogrammen in versiegelter Verpackung gemäß 312g Abs. 2 Nr. 6 BGB gilt das Widerrufsrecht nicht, wenn das Siegel nach der Übergabe beseitigt worden ist. Diese Bestimmung hat den Grund, dass der Konsument daran zu hindern ist, den Datenträger inhaltlich zu vervielfältigen und dann das Widerrufsrecht ausübt.
2.4 Wie sehen die Stornierungsbedingungen aus? Onlinehändler sind zwar nicht dazu gezwungen, ein solches Schema zu nutzen, dies wird jedoch aus Praktikabilitäts- und Rechtssicherheitsgründen empfohlen. Shopbetreiber stehen vor einer großen Aufgabe mit der neuen Musterstornierungsrichtlinie: Jeder Einzelhändler muss die Richtlinie an vielen Orten an den jeweiligen Laden adaptieren.
Ein besonders hohes Hindernis muss der Shop-Betreiber mit der Einweisung über den Anfang der Frist des Widerrufs mitnehmen. Im offiziellen Modell der Stornierungsanweisung für Online-Händler sind für den Fristenbeginn bei Fernverkaufsverträgen verschiedene Instruktionsmöglichkeiten vorgesehen, je nachdem, ob nur eine oder mehrere Waren angeliefert werden, ob die Waren in mehreren Teilmengen angeliefert werden oder ob es sich um eine Einmal- oder eine Dauerlieferung von Gütern handeln soll.
Für Shopbetreiber bedeutet das: Die zu gebende Sperranweisung muss aufgrund des abweichenden Fristbeginns auf die jeweilige Auftragslage abgestimmt sein. Das Problem dabei ist der Umstand, dass der Konsument mehrere Waren gleichmäßig aufnimmt. Weil der Auftragnehmer hier schon in der Bestellzeit wissen müßte, ob er diese Ware in einer Anlieferung versenden kann oder ob eine Teilbelieferung notwendig wird, die er aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht regelm?
Aus diesem Grund wird manchmal vorgeschlagen, mehrere für den Beginn des Zeitraums maßgebliche Abweichungen aus dem Rechtsmodell einfach Seite an Seite in die Stornierungsanweisungen aufzunehmen. Allerdings steht diese Vorgehensweise eindeutig im Widerspruch zu der legislativen Idee, die darauf zielt, immer nur eine einzige Alternative vorzustellen. Eine andere Möglichkeit ist, nur eine einzige zu benutzen, nämlich die, die grundsätzlich für alle vorstellbaren Bedeutungskonstellationen gilt: Sie basiert also für den Beginn der Periode einfach immer darauf, wann das "letzte Produkt" in Gebrauch war.
In der Entscheidung über eine Widerrufsanweisung, die der oben beschriebenen ersten Lösung mit der Vorlage mehrerer Ausführungen folgte, mussten die Juroren beschließen. Eine solche Sperranweisung, die dem Konsumenten den Anschein vermittelt, dass mehrere Möglichkeiten des gleichzeitigen Eingreifens bestehen, sei nicht zulässig. Shopbetreiber haben nun die Qual der Wahl: Zum einen haben sie die Chance, mit einer "dynamischen" Stornierungspolitik zu operieren.
Ein solcher dynamischer Stornoauftrag erzeugt den Baustein zu Stornobeginn einzeln auf Basis der entsprechenden "Warenkorbsituation" in Realzeit und zeigt diesen nur dem Konsumenten an. Shopbetreiber sollten daher so weit wie möglich - und dies ist die zweite Option, auf die sie nach dem Recht Anspruch haben - mit einer stationären Sperranweisung vorgehen. Insbesondere in solchen Situationen, in denen Online-Händler sowohl einmalige als auch permanente Lieferung bieten, ist es fast nur möglich, mit einer Stornoregelung zu operieren, die für beide Varianten separate Anweisungen zum Kündigungsbeginn gibt.
Darüber hinaus müssen die Shopbetreiber in der Musterkündigungsanweisung ihren Name, Adresse und "falls vorhanden" Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse anführen. Zukünftige Online-Händler, die über die oben erwähnten Kommunikationswege miteinander in Kontakt treten, sollten diese ebenfalls in der Widerspruchsbelehrung anführen. Die fehlenden Angaben einer Rufnummer in der Sperranweisung sind, wie bereits erläutert, ein warnfähiger Wettbewerb.
Online-Händler haben prinzipiell die Option, dem Konsumenten die Rücknahmekosten aufzubürden. Die Weitergabe der Rücksendungskosten an den Konsumenten ist jedoch bei nicht paketversandfähigem Gut schwierig. Die Rücksendungskosten müssen in diesem Falle vom Unternehmen veranschlagt und in der Rückgabebelehrung ausgewiesen werden. Ein entsprechender Widerruf muss sich daher mit der jeweiligen Sorte der Waren in einer ausgefeilten Weise befassen.
Neben der Belehrung zum Widerspruch muss der Shopbetreiber dem Kunden ein Widerrufsformular zur Verfügung stellen. Dies soll dem Konsumenten die Gelegenheit bieten, seinen Widerspruch so leicht wie möglich mit dem zur Verfügung gestellten Formular zu erklÃ?ren. Mit dem Widerrufsformular liegt aber auch der Teufel genau im Detail: Shopbetreiber müssen einige berücksichtigen, damit das Widerrufsformular recht sicher in den Onlineshop eingebaut wird.
In einer FAQ zum Widerrufsformular hat die Kanzlei IT-Recht alle erforderlichen Angaben aufbereitet. Ebenso wie der richtige inhaltliche Aufbau der Widerspruchsbelehrung ist die rechtlich sichere Integration der Widerspruchsbelehrung in das Shopsystem von Bedeutung. Aber wann und wo muss der Ladenbesitzer den Konsumenten über das Widerrufsrecht informieren? Darauf gibt Artikel 246a, 4 Abs. 1 EGBGB n. F. eine Auskunft.
Darüber hinaus sieht Artikel 246a, 4 Abs. 3 S. 1 des Einführungsgesetzes zum Einführungsgesetz zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB n. F.) vor, dass die Angaben zum Widerrufsrecht in einer an die verwendeten Kommunikationsmittel angemessenen Form, z.B. durch Hinterlegen auf einer klar gekennzeichneten (und verlinkten) Informationseite, zugänglich gemacht werden müssen. 246a des Einführungsgesetzes zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB n. F.) führt auch zur nachvertraglichen Informationspflicht (einschließlich des Widerrufsrechts) auf einem permanenten Medium, d.h. als E-Mail-Text, PDF-Dokument oder in gedruckter Form.
Auch das Widerrufsformular sollte sich auf der Online-Shop-Seite finden, am besten in der unmittelbaren Umgebung der Widerspruchsbelehrung. Warnungen wegen fehlenden oder unzureichenden Widerrufsbelegs sind in diesem Land ein ständiges Problem. Shopbetreiber sollten daher auf der sicheren Seite sein und sich frühzeitig mit dem Gegenstand der Sperranweisung befassen. Zum Verfasser: Max-Lion Keller (LL. M.) ist Partner der IT-Recht Kanzlei München und Spezialist für deutsches Online-Recht.