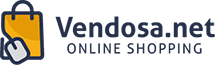Gegen Allergie
AllergieBei hypersensibler Reaktion unseres Immunsystems können Allergieerkrankungen die Folgen sein. Aber was geschieht im Organismus und welche Behandlung ist hilfreich bei Heu-Fieber, Aspirin usw.? Naschen von Erdnüssen, Wandern neben einer Blumenwiese, Streicheleinheiten für die Nachbarkatze: Die häufigsten Aktivitäten können für Allergienkranke zu einem echten Verhängnis werden. Je nach Allergieart reagieren Sie defensiv auf Fremdstoffe wie z. B. Blütenstaub oder Tierhaar, so genannte Allegene.
Juckreiz und Neurodermitis auf der Lederhaut können ebenfalls auf eine Allergie deuten. Schlimmstenfalls kann es zu einem Allergieschock kommen, der bis hin zum Atem- und Kreislaufstopp reichen kann. Egal ob stark oder mild, viele Menschen sind allergisch. Nach Angaben der European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) haben in Deutschland rund 25 Mio. Menschen eine Allergie.
Die am häufigsten auftretende Blütenstauballergie manifestiert sich vor allem im Heu. Doch auch andere Allergiearten können die Wohnqualität einschränken: Kontaktallergie, Allergie gegen Bronchialasthma und Lebensmittelallergien, Haushaltsstaubmilben oder Schadinsekten. Wie geht es mit einer Allergie im Organismus weiter? Absorbiert der Organismus über den Magen-Darm-Trakt, die Nasen oder die Körperhaut eine Fremdsubstanz, überprüft das Abwehrsystem, ob es sich um einen Erreger auswirkt.
Manchmal kann das Abwehrsystem nicht zwischen gesundheitsschädlichen und problemfreien Stoffen differenzieren und widersteht schlagartig harmlosen Stoffen, wie sie in Blütenstaub oder Schalenfrüchten vorzufinden sind. Ärzte nennen eine solche Verhaltensweise des Abwehrsystems Sensitivität. Nur wenn es durch Krankheitserscheinungen auffällt, wird von einer Allergie gesprochen. Allergische Symptome treten in der Regel nicht unmittelbar nach dem ersten Umgang mit dem Allergieerreger auf, sondern erst nach wiederholtem Umgang.
Abhängig davon, wie das Abwehrsystem auf eine Substanz anspricht, gibt es vier unterschiedliche Arten von Allergie, von denen die Typen I und IV die gebräuchlichsten sind. Allergie des Typs I: Rund 90 Prozentpunkte aller Allergiefälle gehören zum sogenannten Type I, auch bekannt als durch IgE verursachte oder unmittelbar auftretende Allengien. Dazu gehören z.B. Allergie gegen Gras- und Bäumchenpollen, Haushaltsstaubmilben, Lebensmittel, Bienen- und Wespengifte und Tierhaare. Die meisten von ihnen sind in der Schweiz ansässig.
Die Abwehrkräfte bilden gegen die Allergene Immunglobuline der Wirkstoffklasse IgE (Immunglobulin E), um sie zu ertragen. Bei der Erkennung des Allergens bewirken die so genannten Imagefilme ( "IgE-Antikörper") die Ausschüttung von Entzündungsbotschaftern wie beispielsweise Hexaminen. Dadurch werden Symptome wie Anschwellen der Hautstelle oder der Schleimhaut ausgelöst - und das nur wenige Gehminuten bis wenige Std. nach Berührung mit dem Allergieauslöser.
Hierbei formt das körpereigene System Immunabwehrstoffe gegen Komponenten der Körperzellenoberfläche. Erkennt der Wirkstoff diese zellulären Strukturen, aktiviert er das Verteidigungssystem. Daher spricht man auch vom Typ der cytotoxischen Allergie, was "zelltoxisch" ist. So kann eine solche Immunreaktion beispielsweise gegen die roten Blutkörperchen gerichtet werden, wenn ein falsches Blutzufuhrsystem vorliegt.
In dieser Art von Allergie werden aus Allergiegenen und Antikoerpern Abwehrkomplexe gebildet, die sich im Gewebesystem (z.B. in der Niere) oder in den Blutgefässen absetzen können. Beispielsweise kann sich eine Vaskulitis-Allergie entwickeln. Da 24 bis 48 Std. zwischen Berührung und Symptomen liegen können, nennt der Arzt diese Art der Spättyp-Allergie auch als solche.
Typisch ist ein allgisches Kontakekzem, das z.B. durch Nickelsäure oder Duftstoffe auslöst. Für die Entwicklung sind allergiespezifische Abwehrzellen, so genannte Helfersche Lymphozyten, zuständig. Tritt der Betreffende nach der Sensitivierung wieder mit dem gleichen Allergieprodukt in Berührung, migrieren die allergiespezifischen T-Helferzellen in die Hautstelle und verursachen ein Allergie-Kontaktrisiko.
Eine Neigung, auf unbedenkliche Substanzen wie Baum- oder Graspollen mit einer durch IgE verursachten Allergie zu wirken, ist gegeben. Bei dieser Disposition leidet man öfter als andere unter Heu-Fieber, allgischem Bronchialasthma und Lebensmittelallergien. Zugleich haben die meisten Patientinnen und Patientinnen eine trockene Hautsituation, die zu Neurodermitis (atopisches Ekzem) führen kann. Allerdings gehört die Neurodermitis selbst nicht zu den Allergieerkrankungen.
Oftmals geschieht dies auch ohne den Einsatz von Allergieauslösern. Damit man herausfinden kann, gegen welche Substanz ein Pflegebedürftiger eine Allergie hat, wird zunächst von einem Allergologen ein Anamnese-Interview durchgeführt. Abhängig davon, welcher Allergenauslöser vermutet wird, gibt es mehrere Diagnoseverfahren: den Pricktest: Abhängig davon, welche Allergene vermutet werden, dribbelt der behandelnde Mediziner geeignete Allergene auf die Innenseite der Vorderarme und durchbohrt sie mit einer Schaufel leicht in die Scham.
Wenn das Abwehrsystem auf die Fremdkörper anspricht, formt die Schale innerhalb von 15 bis 20 min eine Quadrate und errötet. Blutuntersuchung: Sie wird oft zusätzlich zum Stacheltest verwendet und kann die IgE-Antikörper im Blutsystem nachweisen, die gezielt gegen gewisse Allergieauslöser gerichtet sind. Zu diesem Zweck haften sie für ca. 48 Std. Allergenpräparate auf den RÃ?cken.
Wenn das Abwehrsystem darauf anspricht, bilden sich Ekzeme oder Blasen. Dabei tropft der Arzt die Allergielösung unmittelbar auf die Nasennasenschleimhaut oder Konjunktiva. Es wird in der Regel in einer Krankenstation durchgeführt, da es eine schwerwiegende Allergie hervorrufen kann, die umgehend auftritt. Sobald tierische Haare, Schalentiere, Muttern usw. als Auslöser von Allergien erkannt wurden, können Allergien am besten Symptome vermeiden, indem sie die entsprechenden Allergieerreger vermeiden.
Mit einigen Allergieerkrankungen wie z.B. Heu-Fieber ist dies jedoch nahezu unmöglich. Für Allergiker vom unmittelbaren Typ gibt es oft die Variante einer allergen-spezifischen Immungotherapie (abgekürzt SIT), auch als Unter- oder Überempfindlichkeit sreaktion oder Entsensibilisierung bezeichnet. Zielsetzung dieser Behandlung ist es, das Abwehrsystem an die Allergie auslösenden Substanzen zu gewöhnt und damit seine übermäßige Wirkung zu schwächen. Zu diesem Zweck injiziert der behandelnde Mediziner den Patient in gewissen Zeitabständen mit einer steigenden Dosierung eines Allergenpräparats.
Teilweise kann das Allergieauslöser auch in Tablettenform oder als Drops verabreicht werden. Egal ob Graspollen, Imkergift, Pharmazeutika oder Düfte: Im Verlauf ihres Lebens können Menschen Allergien gegen jede beliebige Droge auslösen. Insbesondere bei Kindern von Erziehungsberechtigten mit Neurodermitis wie z. B. Heu-Fieber, allergisches Bronchialasthma und Neurodermitis besteht ein höheres Risiko, an der Krankheit zu erkranken. der Krankheit.
Beraterin: Dr. Angela Unholzer, Dermatologin mit den Zusatzqualifikationen Allergene tik und Dermatomithologie, ist seit 2012 in einer Praxen bei Augsburg mit dabei.