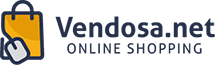Digitale Inhalte Verkaufen
Verkaufen Sie digitale InhalteDie Recht Kanzlei stellt allgemeine Geschäftsbedingungen und Kündigungsrichtlinien zur Verfügung.
Auf einem physischen Speichermedium verkaufen Sie als Unternehmen digitale Inhalte, die nicht an den Endverbraucher ausgeliefert werden (z.B. Download von Programmen, Videofilmen oder Musik) und wollen in diesem Zusammenhang ab dem 13.06.2014 eine rechtlich sichere Widerspruchsbelehrung einführen? Aufgrund der rechtlichen Veränderungen durch die Implementierung der Verbraucherrechtsrichtlinie in das deutsche Recht ist es notwendig, für die Bereitstellung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem physischen Speichermedium an den Endverbraucher übermittelt werden, besondere Widerrufsbelehrungen vom 13.06.2014 vorzusehen.
Widerrufsbelehrung für die Warenlieferung oder die Bereitstellung von Diensten darf nicht für die Bereitstellung von digitalem Inhalt genutzt werden, der nicht auf einem physischen Speichermedium an den Endverbraucher ausgeliefert wird. Digitale Inhalte sind gesetzlich definiert als solche, die elektronisch produziert und zur Verfügung gestellt werden. Sie werden nicht auf einem physischen Speichermedium ausgeliefert, wenn sie zum Herunterladen oder Streaming bereitstehen oder anderweitig auf nicht-physische Weise (z.B. per E-Mail) übertragen werden.
Zu den typischen Fallbeispielen gehören das Herunterladen oder Streamen von Musiktiteln, Programmen, E-Books oder Videofilmen sowie das Angebot von Anwendungen und Online-Spielen. Daher ist es notwendig, für solche elektronischen Inhalte ab dem 13.06.2014 eine besondere Widerrufserklärung zu erteilen. Meiden Sie den überflüssigen Warngrund einer falschen Sperranweisung. Sie sind mit unseren Gesetzestexten auf der richtigen Adresse, auch bei der Bereitstellung von digitalem Content.
Verbraucherrechtsrichtlinie Teil 8: Kauf von digitalen Inhalten
Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen sind für Online-Händler jedoch sehr komplex: So werden beispielsweise neue Vorschriften zum Rücktrittsrecht für den Vertrieb von "digitalen Inhalten" erlassen. Darüber hinaus unterliegen Online-Händler neuen rechtlichen Informationsanforderungen, die beim Vertrieb der Inhalte zu beachten sind. Im Zuge der Überführung der Verbraucherrechtsrichtlinie in deutsches Recht wird das Rücktrittsrecht für den Vertrieb und die Vermarktung der Inhalte geändert.
In Zukunft wird sich auch der Hinweis auf die Informationspflicht beim Kauf bzw. Vertrieb der Inhalte explizit im Recht wiederfinden. Der Begriff "digitale Inhalte" ist in 312 f Abs. 3 BGB n. F. zu verstehen. Digitale Inhalte sind daher "Daten nicht auf einem physischen Speichermedium, das in elektronischer Weise produziert und zur Verfügung gestellt wird".
In der Begründung heißt es, dass sich diese Vorschrift auf Art. 2 Abs. 11 der Verbraucherrechtsrichtlinie bezieht. "Der Begriff "digitale Inhalte" bezeichnet "Daten, die in elektronischer oder gedruckter Fassung erstellt und zur Verfügung gestellt werden". Bei der Einstufung als digitale Inhalte ist es unerheblich, ob auf sie durch Download oder Download in Realzeit (Streaming), von einem physischen Medium oder auf andere Weise zurückgegriffen wird (siehe auch Randnummer 19 der Verbraucherrechtsrichtlinie).
Im Zuge der Übernahme der Verbraucherrechtsrichtlinie in deutsches Recht gibt es eine Änderung im Hinblick auf das Rücktrittsrecht beim Kauf von Inhalten, die nicht auf einem physischen Speichermedium angeboten werden. Eine ausdrückliche rechtliche Bestimmung zum Rücktrittsrecht beim Kauf von Digitalprodukten auf nicht-physischen Speichermedien gibt es bisher nicht. Das Rücktrittsrecht wurde hier abgelehnt.
Allerdings nur, wenn die digitalen Inhalte auf dem nicht-physischen Speichermedium (z.B. Versand des E-Books) zur Verfuegung stehen 312 d Abs. 4 Nr. 1 AGB. Damit haben die Verbraucher ab dem 13. Juni 2014 auch beim Erwerb von digitalen Inhalten auf nicht-physischen Speichermedien ein gesetzlich verankertes Rücktrittsrecht. Wenn digitale Inhalte auf einem physischen Medium wie einer CDS oder DVD angeboten werden, gilt dies als regelmäßiger Verkauf von Waren (siehe auch Randnummer 19 der Verbraucherrechtsrichtlinie).
Das Widerrufsrecht besteht daher ab der Ablieferung der Ware, 356 Abs. 2 Nr. 1 BGB n. Gesetzlich kann der Vertrieb von nicht auf einem physischen Speichermedium bereitgestellten Digitalinhalten weder als Einkaufsvertrag noch als Servicevertrag bezeichnet werden. Die Folge ist, dass auch der Erwerb von digitalem Content auf einem nicht-physischen Speichermedium nicht als Konsumgüterkauf klassifiziert werden kann.
Dies hat zur Konsequenz, dass die Widerrufsfrist bereits mit dem Abschluss des Vertrages anläuft, 356 Abs. 1 Nr. 1 BGB n. F. Der Online-Händler kann jedoch das gewährte Rücktrittsrecht durch eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen aufheben. Der § 356 Abs. 5 BGB n. F. sieht folgende Regelung vor: hat sein Wissen darüber bekräftigt, dass er sein Recht auf Widerruf durch seine Einwilligung mit dem Start der Vertragsdurchführung erlischt.
"Der in Zukunft gültige Informationspflichtenkatalog in Art. 246a EGBGB n. F. ist breiter als bisher. Bestimmte Informationsverpflichtungen werden beibehalten, andere werden ab dem 13. Juni 2014 hinzugefügt. Besonders innovativ sind die im Recht ausdrücklich festgelegten Unterrichtungstätigkeiten. Dabei geht es um das Funktionieren von digitalen Inhalten und deren wesentliche Einschränkungen bei der Vereinbarkeit mit Hard- und Software. In diesem Zusammenhang sind die folgenden Punkte von Bedeutung.
Es stimmt, dass der Online-Händler bereits jetzt dazu angehalten ist, die wesentlichen Eigenschaften des Artikels im Umfang seiner Beschreibung zu benennen, Art. 246 § 1 Abs. 1 Nr. 4 EGBGB. Nach § 246a Abs. 1 EGBGB n. F. ist der Auftragnehmer ab dem 13.06.2014 dazu angehalten, dem Auftraggeber vor Lieferung seiner Vertragserläuterung die folgenden Angaben in anschaulicher und leicht nachvollziehbarer Form zur Verfuegung zu stellen:
Im Falle von Aufträgen über die Bereitstellung von digitalen Diensten sind Informationen darüber, wie diese genutzt werden können, als Teil der Erklärung über die Betriebsart anzugeben. Es sind auch Informationen über bestehende oder nicht bestehende verfahrenstechnische Schutzmassnahmen wie z.B. durch digitale Rechteverwertung oder regionale Kodierung bereitzustellen. Nr. 15: wenn es sich um Material, Einschränkungen der Interaktionsfähigkeit und Vereinbarkeit digitaler Inhalte mit Hard- und Software handelt, wenn diese Einschränkungen dem Unternehmen bekannt sind oder sein müssen.
Bei den Informationen zur Verträglichkeit und Verträglichkeit ist z.B. anzugeben, mit welchem Betriebsystem die Daten der Computersoftware wiedergegeben werden können oder welche Anforderungen die bestehende Hard- und Software erfüllt sein muss. Postvertragliche Informationen über das Funktionieren von digitalen Inhalten, einschließlich der anwendbaren technischen Sicherheitsmaßnahmen und der bestehenden Einschränkungen der Zusammenarbeit und Vereinbarkeit mit Hard- und Software, aufbereitet.
Die Verpflichtung resultiert aus den Artikeln 246a 1 Abs. 1 Nr. 14 und 15 in Verbindung mit 246a 1 Abs. 1 Nr. 14 und 15 in Verbindung mit 246a 1 Abs. 1 Nr. 15 in Verbindung mit 246a Abs. 1 in Verbindung mit 246a in Verbindung mit 246a in Verbindung mit 246a in Verbindung mit einem anderen. Nach § 312 f Abs. 2 BGB n. F. ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber innerhalb einer vertretbaren Zeit nach Vertragsabschluss, längstens jedoch bei Ablieferung der Waren, eine Vertragsbestätigung mit dem Inhalt des Vertrages zu übermitteln.
Sie müssen sich auf einem langlebigen Speichermedium (z.B. E-Mail, Papierausdruck) und leserlich ausweisen und die Identität des deklarierenden Unternehmens angeben, Art. 246a 4 Abs. 3 EGBGBGB. Eine Weiterleitung der Daten ist nicht erforderlich, wenn der Händler seinen Informationsverpflichtungen gegenüber dem Konsumenten bereits nachgekommen ist.
hat sein Wissen darüber bekräftigt, dass er sein Recht auf Widerruf durch seine Einwilligung mit dem Start der Vertragsdurchführung erlischt. Die Konsumenten können die elektronischen Inhalte auf einem nicht-physischen Speichermedium beziehen und nach einem vollständigen Herunterladen weiterhin ein Rücktrittsrecht ausübt. Tritt der Kunde in einem solchen Falle zurück, so hat er keinen Schadenersatz gemäß 357 Abs. 9 BGB n. F... zu erstatten.
Für den Entrepreneur bedeutet dies, dass er das Geldbetrag zwar zurückzuzahlen hat, aber keine Vergütung für die Verwendung der elektronischen Inhalte (z.B. das Betrachten des E-Books) bekommt. In Kuerze wird der Verband des Deutschen Einzelhandels ein White Paper mit Praxistipps und Applikationshinweisen zum Vertrieb und zur Vermarktung bereitstellen.