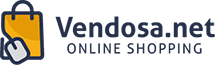Agb homepage
Allgemeine Geschäftsbedingungen HomepageWerden T&Cs überhaupt benötigt? HÄRTING Anwälte
Gerade auf Flugblättern und in Prospekten mit Bestellmöglichkeit bereiten lange Allgemeine Bedingungen Probleme. Für die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung geltenden Form finden die nachfolgenden Allgemeinen Bedingungen Anwendung. "Darüber hinaus erhebt sich die Fragestellung, ob verkürzte Allgemeine Bedingungen auf Flugblättern und in Verzeichnissen eingesetzt werden können.
246a 1 EGBGB müssen prinzipiell - wie bereits oben ausgeführt - zur Kenntnis genommen werden. Gemäß Artikel 246a 3 des Einführungsgesetzes zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) bestehen jedoch bei beengten Platzverhältnissen vereinfachte Auskunftspflichten, wenn ein Fernkontrakt "durch ein Fernkommunikationsmittel abgeschlossen wird, das dem Konsumenten nur beschränkten Platz oder beschränkte Zeit für die zu erteilende Information bietet".
"Was unter Platzmangel zu verstehen ist, ist nicht gesetzlich festgelegt. Allerdings ist die Bewertung, dass ein Bereich beschränkt ist, "wenn ein erheblicher Teil des Werbemittels für komplette Pflichtinformationen genutzt werden müsste". Das Limit ist wahrscheinlich überschritten, wenn der gesamte verfügbare Speicherplatz die Aufzeichnung aller Daten ohne weiteres ermöglicht.
Wenn nur wenig Raum zur Verfuegung steht, muessen nur die nachfolgenden Angaben installiert werden: Gemäß dem Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 18. Februar 2017 ist die Anwendbarkeit von Artikel 246a 3 EBGBGB auf Verzeichnisse und dergleichen nicht möglich. Diese Einschränkung macht den Konsumenten zudem nicht ungeschützt, sondern gibt ihm auf andere Weise Zugriff auf die Information.
Die AGB - Allgemeines zur Nutzung
AGB sind vorgefertigte Vertragskonditionen für eine große Anzahl von Aufträgen (' 3), die ein Vertragsteil (Nutzer) des anderen Vertragsteils bei Vertragsabschluss festlegt. Ein wesentliches Kennzeichen der AGB ist, dass sie vom Nutzer unilateral in den Nutzungsvertrag aufgenommen werden. Es reicht nach einem Gutachten des BGH nicht aus, wenn der Nutzer der AGB den Vertrags-partner von der Vertragsunterzeichnung "befreit"; es ist notwendig, dass der Vertrags-partner die Bedeutung begreift und die eigentliche Einflussmöglichkeit auf den Vertragsinhalt hat.
Eine Verletzung der ABG-Vorschriften kann für den Nutzer schwerwiegende Rechtsfolgen haben. Sie müssen von Fall zu Fall für das jeweilige Untenehmen ausgearbeitet werden. Bei einer unzulässigen Vorschrift findet im Falle einer Streitigkeit die in der Regel ungünstigere Rechtsvorschrift als die nach dem Allgemeinen Geschäftsbedingungengesetz erlaubte Anwendung. Die eher verwirrende, aber zu beobachtende Rechtssprechung über die Zulassung einzelner Bestimmungen kann nur ein Fachanwalt übersehen.
Es wird eine homogene und differenzierte Regulierung der Rechtsverhältnisse für den Großauftrag geschaffen und damit der Geschäftsablauf vereinfacht. In der Regel sind sie auch dann unverzichtbar, wenn es für die gewünschte Vertragsart (z.B. Factoring, Leasing, Franchisevertrag) keine gesetzlichen Regelungen gibt, nicht ausreichend ist oder aufgrund veränderter ökonomischer Rahmenbedingungen nicht paßt. Diese müssen so gestaltet sein, dass auch ein Nicht-Jurist sie versteht (so z.B. die Klausel: "§ 627 BGB ist nicht anwendbar").
Sie müssen vom Kunden in angemessener Form zur Kenntnis genommen werden können. Bei Geschäften mit Privatpersonen sind aufgrund ihres speziellen Schutzbedürfnisses hinsichtlich der Aufnahmebedingungen strikte Standards anzuwenden: Auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist bei Vertragsabschluss ausdrücklich hinzuweisen. Es genügt nicht, wenn der Nutzer seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf die Rückseiten des Angebotes gedruckt hat, aber nicht auf die Frontseite verweist.
Die erste Erwähnung der AGB in Rechnung, Quittung, Lieferschein und Auftragsbestätigung ist ebenfalls zu spÃ?t! Wenn kein direkter Kundenkontakt besteht, wie z.B. in Parkplätzen, Waschstraßen, etc. Der Nutzer muss bei Internetangeboten darauf aufmerksam machen, dass die AGB in den Nutzungsvertrag aufgenommen werden sollen.
Der Nutzer der AGB muss dem anderen Vertragspartner darüber hinaus die Gelegenheit geben, den Vertragsinhalt in angemessener Form zur Kenntnis genommen zu haben. Deshalb kann der Auftraggeber auch ganz auf die Einreichung der AGB (Nachweisproblem!) verzichtet werden, was insbesondere bei telefonischem Vertragsabschluss wichtig ist. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, kann der Auftrag auch telefonisch unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Auftraggeber die ihm zu übermittelnden AGB anschließend zustimmt.
Im Falle von vertraglichen Angeboten im Netz soll der Besteller die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf seiner Harddisk ablegen und - falls erforderlich - ausdrucken können. Es ist der Durchschnittskunde zu berücksichtigen, d.h. der Nutzer muss keine Übersetzungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für in Deutschland wohnhafte Personen vorlegen. Bei grenzübergreifenden Geschäften ist jedoch darauf zu achten, dass die Bezugnahme auf die AGB und deren Texte in der jeweiligen Verhandlungs- bzw. in einer der Weltsprachen - Deutsch, Spanisch, Französisch und Spanisch - erfolgt.
Abschließend muss der Besteller der Gültigkeit der AGB zustimmen, was immer dann der Fall ist, wenn er dem Vertragsabschluss zustimmt, wenn die vorstehenden Bedingungen erfüllt sind. Für Verträge mit Kaufleuten und Freiberuflern (sofern sie als solche tätig sind) genügt es, wenn der Auftraggeber die Absicht des Auftraggebers erkennt, AGB aufzunehmen und dem nicht entgegensteht.
Allerdings wird aus Rechtssicherheitsgründen auch hier ein expliziter Verweis auf die Verwendung der AGB empfohlen. Sofern die Vertragsparteien in laufende Geschäftsverbindungen treten und hierfür regelmäßige AGB als Grundlage verwendet wurden, ist der Besteller dazu angehalten, einer Aufnahme der bisher angewendeten AGB explizit zu widerstehen, wenn er mit deren Gültigkeit nicht mehr übereinstimmt.
Soweit beide Parteien AGB anwenden, finden nur die entsprechenden Bestimmungen Anwendung. Im Übrigen findet die einschlägige Rechtsvorschrift Anwendung (z.B.: wenn der Bestimmung "Porto wird vom Besteller getragen" die Bestimmung "Transportkosten werden vom Besteller getragen" entgegensteht, hat der Besteller die entsprechenden Aufwendungen zu tragen). Sind die einzelnen Bestimmungen gültig? Dem Risiko, dass AGB-Nutzer ihre Belange unilateral auf Rechnung der Parteien durch Ausnutzung ihrer wirtschaftlichen oder geistigen Minderwertigkeit wahrnehmen (der Umfang der AGB ist für den Auftraggeber in der Regel nicht vorhersehbar), wird durch die Änderung oder Ergänzung gesetzlicher Bestimmungen inhaltlich entgegengewirkt.
Beispielsweise ist eine solche Regelung ungültig, wenn sie den Vertrags-partner unzumutbar beeinträchtigt. BGB, die unter anderem Verzeichnisse verbotener Bestimmungen enthält. Dementsprechend sind z.B. die Bestimmungen unwirksam: Eine Regelung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wonach auch eine Haftung des Nutzers für schwerwiegende Pflichtverletzungen des Nutzers auszuschließen ist, ist nicht wirksam. Ebenso wenig zulässig ist eine Regelung, die eine Zahlungserhöhung für Lieferungen oder Dienstleistungen innerhalb von 4 Wochen vorschreibt.
Beispiel: Der Käufer erwirbt ein Rad für 400 EUR, das beim Fachhändler nicht auf Lager ist und daher nur in 2 Monate lieferbar ist. Im Vertrag mit Endkunden und Unternehmern sind unzulässig: "Reparaturleistungen nur gegen Vorkasse", "Das Recht des Bestellers zur Aufrechnung mit einer unstreitigen Widerklage ist ausgeschlossen" und "Gerichtsstandsvereinbarungen", soweit sie gegen Privatpersonen oder nicht im Firmenbuch eingetragene Kaufleute gerichtet sind.
"Sogenannte Überraschende Bedingungen, d.h. solche ungewöhnlichen Regelungen, die bei Vertragsabschluss unter keinen Umständen zu erwarten sind, werden nie Vertragsbestandteil. Auch wenn der Besteller diese Bestimmung unterzeichnet hat, wird sie nicht wirksam. Im Falle unklarer oder unklarer Formulierungen geht dies zu Ihren Lasten. Die für den Auftraggeber vorteilhafteste Interpretation der Bestimmung findet dann Anwendung, da der Nutzer die Gelegenheit gehabt hätte, sich deutlicher zu äußern.
Die AGB im geschäftlichen Verkehr mit Gesellschaften Die AGB im geschäftlichen Verkehr mit Gesellschaften unterliegen nicht ganz so streng. Geschäftsbeziehungen mit Firmen bedeuten, dass beide Parteien Firmen sind und jede kommerzielle oder freiberufliche Aktivität beinhalten. Es ist jedoch aus rechtlichen Gründen und zur Vermeidung späterer rechtlicher Auseinandersetzungen empfehlenswert, in jedem einzelnen Vertrag auf die AGB Bezug zu nehmen und damit dem Vertrags-partner die Gelegenheit zu geben, das Gebot zu Ihren Vertragskonditionen anzunehmen oder in neue Vertragsverhandlungen zu treten.
Hinsichtlich der widersprüchlichen Bestimmungen gilt die entsprechende gesetzliche Vorschrift. Im Gegensatz zum Endkunden sind die AGB im geschäftlichen Verkehr mit Unternehmern nur eingeschränkt inhaltlich kontrollierbar. Aber auch hier darf es keine Abweichung vom Kerngedanken der Rechtsvorschrift geben (§ 307 Abs. 2 BGB).