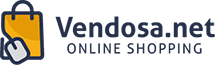Verkauf nur an Gewerbliche Kunden
Nur an gewerbliche Kunden verkaufenOnline-Anbieter können den Verkauf ihrer Waren an Unternehmenskunden (Business-to-Business, B2B) generell einschränken. Dies kann nützlich sein, da z.B. die angebotene Ware auf jeden Fall nur für die Bedürfnisse von Händlern gedacht ist und bei einer solchen B2B-Transaktion keine Verbraucherschutzbestimmungen zu beachten sind. Wenn Gewerbetreibende ihre Waren über das Netz vertreiben, müssen sie die geltenden Verbraucherschutzvorschriften, wie das Rücktrittsrecht und Anweisungen, einhalten, es sei denn, sie handeln eher an Gewerbetreibende als an Konsumenten.
Die Vereinfachung kann jedoch zu einer Verwarnung nach sich ziehen, wenn der Kundenstamm nicht klar genug auf Firmenkunden begrenzt ist oder wenn der Ausschluß von mit Konsumenten geschlossenen Verträgen nicht ausreichend gewährleistet ist. Im vorliegenden Falle besteht ein Verstoß gegen die Verbraucherschutzbestimmungen und damit ein Verstoß gegen den Wettbewerb. Der Online-Händler muss daher an geeigneten Stellen ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass sein Leistungsangebot nur für Firmenkunden und nicht für Konsumenten bestimmt ist.
Beispielsweise wurde der rot markierte Vermerk "Nur für gewerbliche Kunden" auf der Startseite des Online-Shops als ausreicht. Darüber hinaus musste der Kunde im Rahmen des Bestellvorgangs eine Kaufzusicherung geben (Landgericht Berlin, Beschluss vom 10. Januar 2016, Ref.: 102 O 3/16). Andererseits ist ein schriftlich und positionell leicht übersehbarer oder erst nach dem Blättern sichtbarer Vermerk, der keine klare Einschränkung für gewerbliche Kunden beinhaltet, ebenso unzureichend wie eine bloße Bekanntmachung in den Allgemeinen Geschäftsbedinungen (Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 26. Oktober 2016, Ref.: 12 U 52/16).
Das OLG Hamm hatte zudem in dem oben genannten Beschluss angefochten, dass von den vom Kunden bei der Anmeldung oder Beauftragung vom Kunden ausgefüllten Pflichtfeldern nur das Eingabefeld "Unternehmen" kein Pflichtfach sei. Selbst wenn ein Nichtverbraucher nicht immer ein Unternehmen nach Handelsrecht haben muss, kann die optionale Eintragung eines Unternehmens durch einen Konsumenten den Anschein erwecken, dass die gewerbliche Verwertung keine Grundvoraussetzung für die Anmeldung oder Beauftragung ist.
Ausschlaggebend für die Voraussetzungen einer wirksamen Einschränkung kann auch sein, an wen sich das Produktangebot des Online-Händlers wendet. Wenn sich aus der Art des Produkts bereits ergibt, dass sich das Produkt nicht an Endverbraucher wendet (z.B. Accessoires für Großformatdrucker), kann es erforderlich sein, eine andere Norm anzuwenden als bei der Online-Verteilung von Erzeugnissen, die in der Regel auch von Endverbrauchern erworben werden.
Wird trotz einer effektiven Einschränkung ein Kaufvertrag mit einem Konsumenten abgeschlossen, weil er den Online-Händler (im Falle eines Probekaufs) über seinen Geschäftsstatus irregeführt hat, kann sich der Kunde nachträglich nicht auf die Beachtung der Verbraucherschutzbestimmungen verlassen. Auch kann ein Mitbewerber einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht nicht auf einen von ihm selbst veranlassten Testerwerb - auch aufgrund falscher Informationen - zurückführen (Bundesgerichtshof, Beschluss vom 12. Juni 2017, Az.: I ZR 60/16).
Wenn Online-Händler ihre Umsätze mit Unternehmenskunden effektiv einschränken wollen, sollten sie dies auf ihrer Homepage klar angeben und für jedermann unmittelbar nachvollziehen. Außerdem sollten die Informationen des Unternehmens ein Pflichtfeld in der Datenanfrage sein und der unternehmerische Status des Kunden bei der Anmeldung oder dem Bestellprozess noch einmal nachvollzogen werden.
Auch eine Einbeziehung der Einschränkung in die AGB ist notwendig, aber ohne weitere Informationen nicht aussagekräftig. Im Lichte der vorstehend beschriebenen Fallrechtsprechung wäre es nicht mehr notwendig, die unternehmerische Situation jedes Kunden im Detail zu untersuchen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt wären.