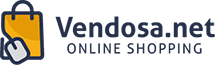Online Verkauf recht
Internet-VerkaufsrechtEinen weiteren Pluspunkt gegenüber dem Stationärgeschäft stellt die höhere Kundenbindung dar. Wo ein stationärer Shop nur im gleichen Quartal oder in der gleichen Großstadt seine Abnehmer findet, können Shop-Betreiber mit einem Online-Shop weltweite Abnehmer finden. Darüber hinaus entfallen im Online-Shop natürlich auch die Miet- und Personalkosten. Andererseits ist die Einrichtung eines Online-Shops auch mit viel Aufwand behaftet.
Dabei müssen die Fachhändler neben der genialen Produktidee und der fachlichen Umsetzbarkeit auch eine Vielzahl rechtlicher Gesichtspunkte berücksichtigen: Inwiefern kann ich das Druckbild im Onlineshop rechtmäßig sicher platzieren? Was bedroht mich denn nun konkret, wenn ich für meinen Laden Produktaufnahmen aus anderen Online-Shops verwende? What is to be observed legal" bemüht sich, all diese Fragestellungen durch eine Reihe von inhaltsbezogenen Themenkomplexen zu erörtern.
Rechtssicherheit beim Online-Verkauf von Waren an Konsumenten in anderen EU-Ländern nahezu ausgeschlossen
Grenzüberschreitender Warenhandel hat für Unternehmen und Konsumenten viele Vorteile - vor allem innerhalb der EU. Es können jedoch Rechtsprobleme entstehen, vor allem in Bezug auf die Fragen des auf Verkaufsverträge anzuwendenden Gesetzes. Es stimmt, dass Unternehmen prinzipiell das Recht festlegen können, nach dem der Verbrauchervertrag durch eine Klausel der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt werden soll.
Solche AGB-Klauseln gelten jedoch nicht immer als rechtswirksam nach der ständigen Gesetzgebung der Bundesgerichte. Der Kauf und Verkauf im Netz - Online-Shopping - ist dagegen nicht einmal wirklich ein europäisches Phänomen. Der Online-Handel ist derzeit enormen rechtlichen Risiken beim Verkauf seiner Waren an Konsumenten außerhalb der EU unterworfen. Der Verbraucherschutz erfolgt durch die EU, vor allem im Rahmen von Verkaufsverträgen und vor allem im E-Commerce.
Darüber hinaus können sie sich jederzeit auf die Verbraucherschutzbestimmungen ihres Wohnsitzlandes verlassen, gleichgültig welches Recht für den Rest des Kaufvertrages anwendbar ist. Sie müssen ebenso wie der wesentlich härtere Finanzwettbewerb der großen Lieferanten von Amazon & Cie. auch die Konsumenten nach dem Recht des Landes, in dem sie wohnen, über ihr Rücktrittsrecht im Fernabsatz informieren.
Wenn Online-Händler diese Bestimmungen nicht einhalten, können sie von Wettbewerbern oder (Verbraucherschutz-)Verbänden verwarnt werden. Die Komplexität und die rechtlichen Schwierigkeiten des E-Commerce in der EU lassen sich an einem Alltagsbeispiel veranschaulichen: Das kleine Online-Handelsunternehmen ABC mit Sitz in Deutschland vertreibt über seinen Web-Shop Waren an Endverbraucher in Deutschland und anderen EU-Ländern, darunter Österreich und Polen.
ABC ist es gesetzlich erlaubt, seine Kaufverträge mit Österreichischen und Polen auf das deutsche Handelsrecht zu stützen. In der EU können sich ausländische Konsumenten jedoch auf das Verbraucherschutzgesetz ihres Wohnsitzlandes verlassen. So können sich die Polen auf die Verbraucherschutzgesetze in Polen und die Österreicher auf die Verbraucherschutzgesetze in Österreich verlassen.
So können die Polen damit rechnen, dass sie über ihr Rücktrittsrecht beim Fernabsatz nach polnischem Recht informiert werden. Gleiches trifft auf den Österreichischen Konsumenten und das Österreichische Rücktrittsrecht zu. Jedem EU-Mitgliedstaat steht es jedoch offen, bei der Übernahme des Gesetzes in nationales Recht über die Mindestanforderungen der EU hinauszugehen zu gehen und das Rücktrittsrecht des Konsumenten in seinem eigenen Staat weiter auszubauen.
Informiert der dt. Online-Händler den dt. Konsumenten nicht ordnungsgemäß über sein Rücktrittsrecht nach polnischem Recht, so verstößt er gegen das Gesetz. Es handelt sich nach nationalem Recht um einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, vor dem Wettbewerber oder Verbraucherschutzverbände warnen können. Vergleichbare Wettbewerbsregeln gibt es in den Rechtssystemen der anderen EU-Mitgliedstaaten.
Ende 2011 legte sie einen Vorschlag für ein sogenanntes Common European Sales Law (CFP) vor, das - wahlweise nach Ermessen der beteiligten Parteien des Kaufvertrages - ein einheitliches Vertriebsrecht für die gesamte EU vorsehen würde. Das Design ist jedoch nicht reif und hat insbesondere für die Anbieter eine Vielzahl von Vorteilen.
Hinzu kommt eine EU-Verbraucherrichtlinie, die die EU-Mitgliedstaaten bis Ende 2013 in innerstaatliches Recht umsetzen müssen. Online Händler sind gut positioniert, um ihre Waren an in- und ausländische Konsumenten zu verkauf. Sie können in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ihre Kaufverträge mit Konsumenten auf das Kaufrecht eigener Wahl stützen - und zwar ungeachtet des Landes, in dem die Konsumenten als Konsumenten ihren Sitz haben.
Die 27 Rechtssysteme der 27 EU-Mitgliedstaaten sind für sie da. Sie können entweder das für sie vorteilhafteste Recht oder das bekannteste Ankaufsrecht ihres Wohnsitzlandes aussuchen. Welches Recht findet ohne Gesetzeswahl Anwendung? Es besteht keine Verpflichtung für den Käufer, eine Gesetzeswahl zu treffe. Der Gesetzgeber regelt, was zu beachten ist, wenn keine freie Wahl des Rechts getroffen wurde.
Der Schwerpunkt liegt auf der EU-Verordnung (EG) Nr. 593/2008 über das auf Vertragsverpflichtungen anwendbare Recht (sog. Rom I-Verordnung). a Für den Erwerb von beweglichen Gütern ist das Recht des Landes, in dem der Verkau ufer seinen ordentlichen Wohnsitz hat, auf den Verkaufsvertrag anzuwenden. Das trifft jedoch nicht zu, wenn der Käufer seine Waren an Konsumenten ausliefert.
Gemäß Art. 6 Abs. 1 gilt dann immer das Recht des Landes, in dem der Konsument seinen ordentlichen Wohnort hat, wenn der Veräußerer auch in diesem Land seine Geschäftstätigkeit ausübt. In diesem Fall gilt das Recht des Landes. Das heißt, wenn ein Online-Händler seine Waren zu seinen eigenen Bedingungen an in Frankreich ansässige Konsumenten veräußert, gilt für den Verkaufsvertrag das französische Recht, sofern keine andere (ausdrückliche) Gesetzeswahl getroffen wurde.
Ein Online-Händler ist besser gerüstet, seine Kaufverträge mit Konsumenten auf der Grundlage eines bestimmten Rechts durch eine freie Wahl des Rechts zu gestalten. In Übereinstimmung mit Art. 3 Abs. 1 der Rom-I-Verordnung kann der Veräußerer das auf ihn anwendbare Recht selbst bestimmen. Er kann z.B. das Recht des Landes auswählen, in dem er oder die Mehrheit seiner Mandanten ansässig sind.
Es ist auch möglich, das Recht eines Drittlandes zu wählen, zu dem weder der Veräußerer noch der Konsument ein besonderes Verhältnis haben, dessen Rechtssystem jedoch für den Veräußerer vorteilhaft ist. Obwohl die Gesetzeswahl mit dem Käufer abgestimmt werden muss, kann der Veräußerer dies auch durch eine korrespondierende Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelgen.
Bedauerlicherweise trifft die Wahl des Gesetzes nicht in vollem Umfang und für jede Fallaufstellung zu. Einerseits sieht Art. 3 Abs. 3 immer die Anwendbarkeit der verbindlichen Regeln des Rechtes des betreffenden Staats vor, der auch eine besonders starke Verbindung hat. Ein kleines Beispiel: Wenn ein in Deutschland ansässiger Online-Händler für seine Verkaufsverträge mit z. B. auch in Deutschland ansässigen Konsumenten das irische Vertriebsrecht festlegt, gelten neben dem österreichischen auch die nicht vertraglich abweichenden Bestimmungen des österreichischen Vertriebsrechts, d. h. das verbindliche dt. Zivilrecht.
Andererseits - und das ist eine noch stärkere Belastung für Online-Händler - kommen immer die verbindlichen Verbraucherschutzbestimmungen des Landes zur Anwendung, in dem der betreffende Konsument seinen Wohnort hat. So unterliegt ein in einem EU-Mitgliedstaat niedergelassener Online-Händler beim Abschluß von Verbraucherverträgen mit Konsumenten trotz Rechtswahl für alle seine Vertragsabschlüsse den 27 Verbraucherschutzrechten.
In einigen Faellen ist nicht einmal klar, welche spezifischen Regeln gelten werden. Jeder, der Waren aus Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedstaat an Konsumenten in der gesamten EU der 27 Mitgliedsstaaten vertreibt, muss die Verbraucherschutzgesetze aller 27 EU-Mitgliedsstaaten einhalten, auch wenn er das Vertriebsrecht seines Heimatstaates oder eines anderen EU-Mitgliedsstaates durch ausdrückliche Gesetzeswahl mitbestimmt hat.
Auch bei der Durchsetzung ihrer Rechte und bei rechtlichen Auseinandersetzungen mit Verbrauchern, die in anderen EU-Ländern ansässig sind, erleiden OnlineHändler einen Nachteil. Obwohl die Verbraucher ihre Streitigkeiten entweder vor den Gerichten des Landes, in dem der Gewerbetreibende niedergelassen ist oder in dem sie selbst ihren Wohnort haben (Artikel 16 Abs. 1 der Verordnung), anhängig machen können, müssen OnlineHändler ihre Streitigkeiten immer vor die Gerichte des Verbraucherstaates bringen (Artikel 16 Abs. 2 der Verordnung).
Auch wenn der Online-Händler in Einzelfällen davon abweicht, sind diese Optionen sehr eingeschränkt (Artikel 17 EGV). Für einige Rechtsgebiete, wie z.B. das Telemedienrecht, ist in der EU das sogenannte Ursprungslandprinzip anwendbar. Dementsprechend muss ein Telemedienanbieter zum Teil nur das Recht des Landes respektieren, in dem er seinen Sitz hat.
Diese ist z.B. in 3 des TMG verankert, das auf Art. 3 der EU-Verordnung (EG) Nr. 2000/31/EG über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Dienstleistungen der Informationsgesellschaft, vor allem des E-Commerce, im Binnenmarkts (Richtlinie über den E-Commerce) beruht. Das TMG umfasst nahezu alle Website-Betreiber und damit auch Online-Händler.
Die Herkunftslandprinzipien gelten jedoch nicht für alle Rechtsgebiete, sondern nur für die besonderen Bestimmungen des Telemediengesetzes, wie zum Beispiel die Abdruckpflicht des Seitenbetreibers im Intranet. Das Ursprungslandprinzip ist jedoch nicht auf Verkaufsverträge anwendbar. Ein in Deutschland niedergelassener Online-Händler muss beispielsweise das Erscheinungsbild seines Web-Shops nicht an das französische Recht anlehnen, wenn er seine Waren auch an in Frankreich ansässige Konsumenten vertreibt.
Ungeachtet einer besonderen Gesetzeswahl (siehe oben) muss er jedoch mindestens das nationale Verbraucherschutzgesetz einhalten und seine europäischen Verbraucher über ihr Rücktrittsrecht nach dem franz. Handelsrecht informieren. Im Telemedienrecht ist das Ursprungslandprinzip eine gesetzliche Vorgabe. Eine Anpassung der Ausgestaltung einer Webseite - etwa im Bezug auf das Aufdruck - an die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Rechtssysteme ist aus technischer Sicht kaum möglich oder wenig sinnvoll.
Demgegenüber kann ein Online-Händler gezielt kontrollieren, mit wem er einen Verkaufsvertrag abschliessen möchte. Der Kunde kann selbst bestimmen, ob er Konsumenten aus gewissen Ländern bedienen will und sich damit den dort gültigen Verbraucherschutzvorschriften unterwirft. Allerdings würde ein kleines Zweifelsfeld damit zusammenhängen, ob ein Großverkäufer Einzelverbraucher benachteiligen kann, indem er sie nicht liefert.
Abschließend wäre eine Ausweitung des Herkunftslandsprinzips auf andere Rechtsgebiete, wie beispielsweise das Vertriebsrecht, in Betracht zu ziehen. In der EU wurde das grundsätzliche Problem anerkannt und am 12. November 2011 ein Vorschlag für eine Verordnung über ein vereinheitlichtes gemeinschaftsweites Vertriebsrecht (CISG) unterbreitet. Aus mehreren GrÃ?nden sollten VerkÃ?ufer und Konsumenten jedoch nicht zu viel Hoffnung in die Lösung der aufgeworfenen MÃ??ngel durch dieses Gesetzgebungsprojekt legen.
Stattdessen müßten die Parteien des Kaufvertrages in ihrem Kaufvertrag explizit festlegen, daß das geltende europäisches Kaufrecht auf den Kaufvertrag anwendbar sein soll. Letztendlich müßte der Auftragnehmer eine korrespondierende Bestimmung in seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen einfügen. Ein Anwalt müsse ihm jedoch davon abhelfen, da dies gegenüber dem Rechtsstatus quo keine Vor-, sondern eher Nachteile bringen würde.
Es stimmt, dass ein Veräußerer - z.B. durch eine korrespondierende Bestimmung in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen - das Recht des europäischen Kaufrechts als Vertragsrecht für alle Käufer seiner Waren festlegen könnte. Im Prinzip würde also nur dieses Recht zusammen mit den darin enthaltenen Verbraucherschutzbestimmungen gelten. Daher müßte der Veräußerer nicht alle 27 kaufrechtlichen Regelungen der EU einschließlich der Konsumentenschutzvorschriften berücksichtigen.
Die Bestimmungen des aktuellen Gesetzentwurfs weisen jedoch einige nachteilige Aspekte auf: So sind die Bestimmungen noch strikter als das deutsche Kaufgesetz, das für unternehmerisch tätige Anbieter bereits streng ist. So sollte der Veräußerer zum Beispiel nicht mehr zu einem zweiten Angebot berechtigt sein. Im Falle eines Sachmangels ist der Besteller berechtigt, unverzüglich vom Kaufvertrag zurückzutreten oder gar Schadenersatz zu fordern, ohne dem Lieferer eine angemessene Nachfrist zur Beseitigung des Sachmangels durch Nachbesserung oder Neulieferung setzen zu müssen.
Darüber hinaus wäre der Auftragnehmer in vielen FÃ?llen schadenersatzpflichtig, auch wenn er kein Schuldbewusstsein hat. Denn es ist nicht ganz richtig, dass der Veräußerer nur das europarechtliche Vertriebsrecht einhalten muss. Bei Kaufleuten, die im gleichen Mitgliedstaat wie der Käufer ansässig sind, hätte der Käufer seine Kaufverträge nach dem dort geltenden innerstaatlichen Handelsrecht abzuschließen.
Dies liegt an der mangelnden Zuständigkeit der EU, das Zivilrecht der jeweiligen Landesrechtsordnungen direkt zu mitzugestalten. Tatsächlich können die EU-Mitgliedstaaten festlegen, dass das gemeinschaftsrechtliche Recht über den Kauf von Waren auch für rein innerstaatliche Angelegenheiten gelten soll. Gegenwärtig ist die Situation sehr schlecht, aber kommerzielle Online-Händler müssen sich damit auseinandersetzen, wenn sie ihre Waren an Konsumenten in anderen EU-Ländern vertreiben wollen.
OnlineHändler, die ihre Waren an Konsumenten im Ausland in der EU vertreiben wollen, haben derzeit nur einen völlig rechtssicheren Weg, dies zu tun. Er hat das Erwerbsrecht eines EU-Mitgliedstaates als Vertragsrecht mit seinen Abnehmern durch AGB-Klausel festzulegen. Das Recht des Landes, in dem der Veräußerer seinen eingetragenen Firmensitz hat, weil er es am besten weiß, ist in der Praxis das am besten geeignete Recht für diesen Zweck.
Der Online-Händler sollte bei der Rechtswahl auch darauf aufmerksam machen, dass der Kunde auch den Verbraucherschutzbestimmungen seines Wohnsitzlandes unterliegt, wenn er ein Konsument ist. Darüber hinaus muss sich der Verkäufer so sicher wie möglich über die Verbraucherschutzbestimmungen aller EU-Mitgliedstaaten unterrichten, in die er seine Waren an Endverbraucher ausliefert. Wenn er es selbst nicht weiß, muss er sich von einem sachkundigen in- oder ausländischen Anwalt eine angemessene Rechtsberatung holen.
Insbesondere sollte der Veräußerer mit den Vorschriften über das Rücktrittsrecht des Verbrauchers im Fernabsatz vertraut sein und diese befolgen, die von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat variieren (bis zu 27), wenn er nicht von einem Wettbewerber gegen Gebühr verwarnt werden möchte. Für die Formulierung der Widerrufsbelehrung gilt das Verbraucherschutzgesetz des Landes, in dem der betreffende Konsument seinen sitz hat.
Die sichersten Wege sind die Vermeidung von Gerichtsverfahren, aber sie sind kostspielig und unwirtschaftlich. Für Online-Händler gibt es neben einer rechtlich sicheren auch einen kostengünstigeren Weg. Dazu gehört es, auch über eine Klausel der Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Gesetzeswahl zu treffen, auf die Gültigkeit der Verbraucherschutzbestimmungen des Wohnsitzlandes des Konsumenten aufmerksam zu machen und dann nur das ausgewählte Recht zu befolgen.
Grundlage für die Wahl des Gesetzes sollte das Handelsrecht eines Landes mit starkem Konsumentenschutz sein, wie beispielsweise das in Deutschland. Dann wären auch die Konsumenten aus anderen EU-Mitgliedstaaten gut geschützt: Diese können noch besser durch die Verbraucherschutzvorschriften des jeweiligen Gesetzes als durch die weniger strengen Verbrauchervorschriften ihres Wohnsitzmitgliedstaats abgesichert sein.
Allerdings besteht nach wie vor das Verlustrisiko, dass Online-Händler gewarnt werden, wenn sie die geltenden Gesetze nicht einhalten. Bei Wettbewerbern ist dies weniger wahrscheinlich, da sie sich in der gleichen unbekannten Rechtslage aufhalten. Das rechtliche und damit auch finanzielle Restrisiko ist nach wie vor eine Selbstverständlichkeit. In der EU besteht eine große rechtliche Unsicherheit.
Obwohl (auch) kommerzielle Anbieter das Recht auswählen können, auf dem sie ihre Kaufverträge auf die Abnehmer stützen wollen, ist dies nicht der Fall. Dennoch können sich die Endverbraucher immer auf die Verbraucherschutzvorschriften ihres Wohnsitzlandes verlassen. Jeder, der Konsumenten in allen 27 EU-Mitgliedstaaten versorgen will, muss 27 Rechtssysteme zum Thema Konsumentenschutz beherrschen - trotz harmonisierender Tendenzen im europ. privatrechtlicher Regulierung.
Dies gilt insbesondere für die Belehrungspflicht mit dem Recht auf Widerruf, in jedem Fall aber unter Beachtung der strikten gesetzlichen Vorgaben in Deutschland. Ein professioneller Anbieter müßte dann die Konsumenten immer über das Recht auf Widerruf des Fernabsatzes informieren, wie es ihnen nach dem Recht des Landes ihres Wohnsitzes zukommt. Zumindest neigen die dt. Gerichtshöfe dazu, diese Rechtsauslegung zu bevorzugen.
Gemäß Art. 6 der Rom-I-Verordnung findet der Schutz des Wohnsitzlandes des Konsumenten trotz anderer Gesetzeswahl immer Anwendung. Dies ist im Hinblick auf den Schutz der Verbraucher im Hinblick auf Gewährleistungsrechte oder andere nachvertragliche Angelegenheiten vergleichsweise problemlos möglich. Online-Händler können bei der Ausübung von Gewährleistungsansprüchen - ohne das Recht des Wohnsitzlandes des betreffenden Konsumenten im Detail zu wissen - aus Kulanzgründen Schwierigkeiten mit Verbrauchern erzeugen.
Handelt es sich jedoch um rechtliche Verpflichtungen des Gewerbetreibenden, die vor oder mit dem Abschluß des Kaufvertrages zu erfüllen sind, wie z.B. die richtige Widerrufsbelehrung auf Seiten des Konsumenten, hat die Gültigkeit des für den Konsumenten in seinem Heimatland anwendbaren Konsumentenschutzes praktische Probleme zur Folge, die zweifellos nicht vorgesehen sind.
Die beiden Hauptziele der EU - Konsumentenschutz auf der einen und Angleichung des EU-Rechts auf der anderen Straßenseite - werden dann eindeutig zu weit auseinander liegen. Letztendlich geht dies auch zu Lasten der Konsumenten, die nicht in der Lage sein werden, die Vorteile eines vollständigen Binnenmarkts zu nutzen. Sowohl die Fallrechtsprechung auf EU-Ebene als auch die EU-Gesetzgeber müssen das Hindernis überwinden, wenn der grenzübergreifende Verkauf von Waren an Endverbraucher optimiert werden soll.
Mittelfristig sollte die EU den Konsumentenschutz im EU-Vertriebsrecht weiter harmonisieren, damit sich die gewerblichen Anbieter nicht mehr auf die verschiedenen Verbraucherschutzgesetze der 27 EU-Mitgliedstaaten verlassen müssen. Die EU-Gesetzgeberin hat das Problem anerkannt und die EU-Richtlinie 2011/83/EU über Verbraucherrechte (die so genannte "EU-Verbraucherrechtsrichtlinie") herausgegeben, die die EU-Mitgliedsstaaten bis zum 14. September 2013 in innerstaatliches Recht umzusetzen haben.