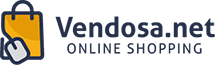Lebensmittelallergie Testen Lassen
Nahrungsmittelallergietest Lassen Sie uns testenDies bietet mehr Gewissheit, vor allem, wenn die anderen Prüfungen nicht oder nicht schlüssig sind. Darüber hinaus ist ein provokanter Test die einzig mögliche Methode, um nicht-allergische Hypersensibilitätsreaktionen zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Diagnosemethoden sind diese Untersuchungen jedoch (zeit-)kostenintensiv und nicht immer harmlos. Im Nasensimulationstest wird bei Vorliegen eines Verdachts auf allergische (Heu-)Rhinitis die Wirkung auf Luftschadstoffe unmittelbar an der Schnauze ausgelöscht.
Das Verfahren zur Nasenprovokation zur Allergiediagnose ist zwar unbedenklich, aber nur in versierten Hände sinnvoll. Der Reiztest Bindehaut (Bindehautentzündung) prüft die Wirkung von Allergenen aus der Atemluft bei einer allergischen Konjunktivitis der Adern. Die Prüflösung wird in den Beutel der niederen Bindehaut getröpfelt und die Wirkung, wie Juckreiz, Tränen und Rötungen, wird nach etwa zehn Monaten bewertet.
Ausgenommen sind negative Provokationen, bei denen keine allergischen Reaktionen zu erwarten sind. Im Provokationstest wird das zu prüfende Futter mündlich gegeben, d.h. durch den Maulkorb verschluckt und eingenommen. Der Zweck der Tests ist es, inkompatible Nahrungsmittel zu erkennen, um sie in Zukunft zu vermeiden - oder die Möglichkeit auszuschließen, zu verhindern, dass gewisse Lebensmittel für die Beschwerden verantwortlich sind und vermieden werden sollten.
Wenn möglich, sollten sie unter Steuerung durch ein Plazebo und ggf. doppelt blind erfolgen (d.h. weder der Patient noch das Testpersonal wissen, ob es sich um das Prüfpräparat oder das Plazebo handelt). Provokationen bei Lebensmitteln sind oft Teil einer Diagnose. Fachleute raten zu häufigeren positiven und vor allem negativen Expositionen.
Insbesondere bei Arzneimitteln, die in der Heilkunde weit verbreitet sind ( "Lokalanästhetika" oder entzündungshemmende Medikamente), wird der Reiztest oft verwendet, um ein alternatives Präparat zu suchen. Aufgrund des potenziellen Risikopotenzials einer gefahrbringenden oder gar lebensbedrohenden Wirkung muss eine Medikamentenprovokation sehr vorsichtig gehandhabt und im Einzelfall ein Gleichgewicht zwischen Vorteil und Gefahr gefunden werden.
Der Verabreichungsweg ist der übliche Verabreichungsweg des Medikaments (meist orale oder Injektion). Bei der oralen Einnahme (über den Mund) ähnelt das praktikable Verfahren dem Provokationstest für Lebensmittel. Diese Prozedur ist sicherer als eine positive Exposition mit der Gefahr einer allg. Auslösung. Daher raten die Fachleute, verstärkt positive und vor allem negative Expositionen vorzunehmen, um einen unberechtigten Allergienverdacht zu widerlegen.
Aufgrund des Gefahrenpotenzials einer lebensbedrohenden Allergie darf eine solche Massnahme nur in einer Praxis unter medizinischer Überwachung und Notfallvorsorge durchgeführt werden. Der Zweck der zufälligen Provokation besteht ausschliesslich darin, den Effekt einer bestimmten Immungotherapie (Hyposensibilisierung) und damit ihre schützende Wirkung gegen das Insektengiftallergieprodukt zu testen.