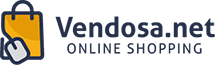Jugendmode Online
Kindermode OnlineAuf T-Shirts bringt sie auch Nachrichten wie "Glaube an deine weibliche Energie". Doch nicht nur mit Statement-Shirts zeigen die Gestalter aktuell eine klare Position. Das " politisches Erwecken der Modewelt " wurde im Frühling in der Washington Post erwähnt; "Forbes" nannte die Politk den "größten Modetrend der New Yorker Fashion Week". Hört sich an, als hätten Donald Trump und Co. die Modewelt aus einem Nickerchen erweckt.
"Auch im antiken Rom, besonders vom Hochmittelalter bis zum Hochbarock, waren gewisse Kleider nur für gewisse Klassen reserviert", sagt Uta-Christiane Bergemann, Kunstwissenschaftlerin mit Spezialisierung auf Fashion und Lehrbeauftragte an der Ruhr-Universität Bochum. Lange bevor die Modewelt entstand, hatte die Bekleidung etwas über die Position ihrer Trägers in der Öffentlichkeit gesagt.
Bekleidung macht deutlich, wer Sie sind - oder wer Sie sein wollen. Dass man morgens keinen Smoking und am Abend keine Shorts im Lokal anhat, ist auch heute noch Teil der Kulturhauptstadt von Pierre Bourdieu. Bereits 1905 hat der Soziologe Georg Simmel in seiner "Philosophie der Mode" detailliert beschrieben, wie sich die höheren Klassen durch Bekleidung von der Menge absetzen wollten, 50 Jahre später entschlüsselte der Philosophiephilosoph Roland Barthes "Die Modesprache".
Früher hatten die Menschen eine Kniebundhose an, nur Seeleute hatten lange Hose als Arbeitsbekleidung auf den Schiffen", sagt Bergemann. Danach nahmen die Revoluzzer lange Hose, um sich vom Hochadel abzuheben - die "Sansculottes", also die Hose ohne Knieschellen, wurden zum politisches Aushängeschild.
Die Großbourgeoisie entdeckte später, dass lange Hose nicht mehr so praktisch war und trug sie von da an ohne jegliche politischen Absichten. Mit langer Hose fällt heute kaum noch jemandem eine Umdrehung ein. Das Halsband, der enge Kragen, der bereits in den neunziger Jahren fast jeden Nacken zwischen Miami und Meippen zierte und gerade sein zweites Revival feiert, darf von seiner vorwiegend jüngeren Fan-Gemeinde nicht als politischer Ausdruck empfunden werden.
Während des Kommunismus in Polen haben junge Menschen den amerikanisch-westlichen Stil der Bekleidung nachgeahmt. Für das Reichsregime war das eine offensichtliche Kritik: "Jedes einzelne Kleidungsstück, mit dem die europäische Verbundenheit Polens betont wurde, dient als Waffen gegen die verordnete Sowjetisierung", schreibt Anna Pelka in einem Essay für die Föderale Agentur für Bürgererziehung im Jahr 2014.
Der SED hingegen versucht, der in der DDR geäußerten modischen Kritiken mit Staatsalternativen zu entgegnen und produziert ab 1974 die von den jungen Leuten so begehrte Denim selbst. Aber das ist kein neuartiges Phänomen", unterstreicht Bergemann: Die englische Gestalterin Vivienne Westwood zum Beispiel nimmt seit Jahren mit T-Shirts Stellung.
Der englische Konstrukteur machte auch den Punk-Bewegungslaufsteg fit. Die Kritik an System und Kapitalismus in Gestalt von zerrissenen Kleidern und Sicherungsstiften wurde so zu dem, was Konstrukteure als "Signaturstück" bezeichneten. Heutzutage können Fibeln mit Swarovski Kristallen in Gestalt einer Sicherheits-Pin und perforierten T-Shirts ein ganzes Geld wert sein.