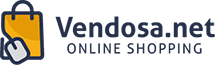Abendkleid kurz Spitze
Nachthemd kurz SpitzeNachdem Sie das Produkt gekauft haben, senden Sie uns die genauen Maße, damit wir Ihr Modell so schnell wie möglich herstellen können. Der Liefertermin beträgt 15-25 Arbeitstage, wenn Sie das Modell vor Ihrer Bestellung unbedingt benötigen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Für eine optimale Anpassung senden Sie uns einfach die folgenden Maße:
Achten Sie jedoch auf die obenstehende Maßtabelle. Probieren Sie es später wieder.
Wunderschöne Vintage-Abendkleider aus Spitze
Schönheitskleider
Wenn Sie nicht die richtige Zeit haben, um eine Jeanshose im Geschäft/Retail Outlet auszuprobieren, sollten Sie das Halsverfahren oft ausprobieren: Es ist möglich, Ihre aktuelle/persönliche Körpergröße zu ermitteln, indem Sie Ihre Hüfte der Jeanshose um den Halsdurchmesser legen. Wenn sich die Hüfte in der Hosenhose entspannt auf den Rücken des Halses legt, dann wird diese Jeanshose sicher in Topform sein.
Unmittelbar nach dem Mangeln sollte man kein Kleidungsstück anziehen, da dies zu Faltenbildung führen kann. Lassen Sie es vielmehr fünf Augenblicke dauern, bis die Maschine eingestellt ist. Wenn du auf ein wenig Kleidung poliert wirst, schichte Wachspapier in die gehärtete Torte und funktioniere dann ein Bügeleisen @[darüber|über die Oberseite der IT|über dieses|über dich|über dich], um dich zu entspannen.
mw-headline" id="Geschichte">Geschichte[Bearbeiten | < Quelltext bearbeiten]
Spitze ist im Kontext von Textilwaren und Bekleidung ein Oberbegriff für sehr verschiedene Dekorelemente, die nur aus Garnen oder aus Garnen und Stoffen besteht. Alle Manifestationen der Spitze haben gemein, dass sie durchbohrt sind, d.h. zwischen den Gewinden werden unterschiedlich große Öffnungen geformt, die zu einem Dekor führen.
So ist beispielsweise ein mit nur einem Muster gestickter Textilstoff keine Spitze. Hauptsächlich wurde und wird Spitze zur Dekoration der Kanten von Bekleidungsstücken eingesetzt, aber es gibt auch "entre-deux Spitze" als Einlage zwischen zwei Gewebestücken, Flachspitzenstoffe (sogenannte Plains) und vor allem seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts von der Bekleidung losgelöste, selbstständige Spitzenobjekte, z.B. als Fensterdekorationen wie Makrameen, Florentinen oder als Tabelle.
Heutzutage wird Spitze für Kleidung vor allem für Unterwäsche, Nachtbekleidung, Frauenoberbekleidung, Brautkleider und traditionelle Kostüme eingesetzt. Spitze wird auch bei der Herstellung von Tischdecken, Vorhängen und liturgischer Kleidung eingesetzt. Der Raum um die Stadt ist das deutschsprachige Mittelzentrum der maschinell bestickten Spitze (siehe Spitze ), während die Gegend um St. Gallen als schweizerisches Textilezentrum betrachtet wird (siehe Spitze St. Gallen).
Man unterscheidet zwei Typen von echter Spitze: Der Nadelkopf und die Klöpperspitze. Aus technischer Sicht entwickelte sich die Nadelstirnfläche aus bahnbrechenden Arbeiten, die Spulenspitze aus Flechtwerk. Der erste Nadelspitz (Reticella) wurde im XVI Jh. in Oberitalien hergestellt und fand im Laufe des XVI Jh. eine breite Ausbreitung.
Die Tips wurden an den Ärmelbündchen befestigt und diente als Halsband für Damen und Herren. Die Popularität beim französichen Adeligen führte zu einem erheblichen Kapitalverkehr nach Italien, dem Ludwig XIV. durch die Förderung der Klöppelherstellung in Frankreich entgegenwirkte. Gegen 1700/1710 ersetzte die kostengünstigere, raschere Klöppelspitzentechnik die Nadelspitzen weitestgehend.
Während die Spitze zu Beginn noch stark gezeichnet war, wurde der Tüllboden mit einem eingearbeiteten oder applizierten Motiv im Laufe des Jahrtausends immer beliebter. Die Tüll-Bodenspitze war wieder einmal rascher und günstiger zu produzieren als die stark gemusterten, so dass sich gegen Ende des achtzehnten Jahrhundert noch weniger reiche Einwohner eine Spitze für den Sonntagabend ertrugen.
Von Beginn bis zur Hälfte des neunzehnten Jahrhundert wurde die Hausarbeitstechnik weiterentwickelt, die von Heimarbeitern in Irland mit größter Perfektion ausgeführt wurde. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhundert war es auch möglich, Spitze und Spitze per Maschine herzustellen, so dass die traditionelle Spitzentechnik vom Erlöschen bedroht war. In der Kurzwarenbranche können Sie Maschinenbohrer (Locher), mit der Maschine bestickte Tüllbohrer, geätzte Bohrer oder die gröberen Macramé-Bohrer kaufen.
Der Ursprung der Reticella-Spitze (rete ital. net ) liegt in Italien in der zweiten Jahreshälfte des XVI. Jahrhunders. Die Garne werden aus einem Leinengewebe entfernt und die entstehenden Bahnen mit einem Knopfstich bestickt, die Öffnungen mit Diagonalfäden gefüllt, die ihrerseits bestickt werden. Werden so viele Garne herausgezogen, dass vom Grundmaterial kaum etwas übrig bleibt, wird von Punto in Aria gesprochen (italienisch: Sticken in der Luft).
Zu den Mustern gehören Weinranken, Blumen und Bäume. Die Nadeldüse hat sich aus der Rticella entwickelt. Dabei wird das Motiv auf einen weißen Pappkarton aufgezogen und dann werden entlang der Skizze die so genannten Pausenfäden gestreckt, die die Basis für die Spitze sind. Gelegentlich werden stärkere Garne auf Gitterteile aufgelegt und bestickt, um eine Reliefoberfläche zu erhalten.
Nadelstiche sind die arbeitsintensivsten Stiche, deren Produktion gute Ohren, viel Gewicht und eine stabile Handfläche voraussetzt. Die östliche Spitze ist auch bekannt als armeische Spitze, grüne Spitze oder Bebill, Smyrna oder Palästina-Spitze, tuerkische Spitze (Oya), Nazareth-Spitze und Astspitze. Die östliche Nadelstirnfläche wird mit Nadeln, Fäden und Scheren hergestellt, mit denen Äste und Bindungen zwischen ihnen hergestellt werden.
Technische Differenzen, die Zahl der um die Kanüle gewickelten Fäden und die Dauer der Knotenverbindung ergeben unterschiedliche Ergebnisse. Die Spitze der Kanüle wird verwendet, um ein Netzwerk zu bilden, das unterschiedliche Konturen annimmt. Zuerst fangen Sie am Rand eines Stoffes an oder Sie beginnen freihand mit der Spitze.
Die Kanüle wird immer vom Korpus weg in das Gewebe oder die Schlaufe eingeführt und die linke Hälfte eingesetzt; dann wird das Ende des Fadens kreuzweise vor der Kanüle in Wirkrichtung gelegt, beide durch das Nadelauge verlaufenden Fäden werden mit Daumen und Zeigefinger aufgenommen und zweifach ( "im Uhrzeigersinn" oder "gegen den Uhrzeigersinn") über die Nadelscheide an der Oberseite gewickelt.
Ziehen Sie nun sorgfältig die Kanüle hoch und achten Sie darauf, dass der Ast offen ist, bis der Garn vollständig durchzogen ist. Die Spitze wird durch Drehen, Weglassen von Bögen und mehreren Ästen in einem Kreisbogen gebildet. Die Luftkette oder der Essstab beim Gehäkeln ist der Garn selbst an der Nadelstirnspitze, der nicht schlanker sein sollte als der Knopflochfaden.
Das Gewinde muss eine starke Verdrehung aufweisen. Die mit dieser Spitze verzierten Bilder armenischer Damen stammen aus dem XIV. Jh.. Sie ist in der zweiten Jahreshälfte des neunzehnten Jh. im ganzen Ottomanischen Kaiserreich, in Kleinasien, auf dem Balkan, auf den Ägäischen Inselchen, in Palästina und Ägypten zuhause.
In Europa war die Spitze dem adligen Geschlecht reserviert, doch die Spitze wurde von den Menschen als Bordüre für Kopftücher, Hemdenkanten und Handtücher, aber auch als Brosche, Tasche und Decke bis hin zur Tischdecke verwendet. Bei der Spitzenherstellung werden Garne nach einem gewissen Schema, den so genannten Beats, gekreuzt oder gedreht. Dabei werden die Kreuzungspunkte durch dünne Nähnadeln an den durch das Modell festgelegten Nadelspitzen festgehalten, bis ihre Lage durch die folgenden Striche festgelegt ist.
Original, handgemachte Spulenkerne werden traditionsgemäß in cremeweiß oder tiefschwarz aus Weiß, Watte oder cremefarbener Silk (blond) hergestellt; heute werden auch gefärbte Garne eingesetzt. Die handgemachte Spitze wird im Erzgebirge, einem traditionsreichen Ort der deutschen Klöppelkunst, noch immer angebaut. Mechelenspitze: Rokokosspitze, bei der ein kräftiger konturierter Leinenfaden das Motiv umgibt. Brüssler Spitze: Sie ist in Klöppelspitze und Nadeltechnologie erhältlich.
Besonderheit ist die getrennte Produktion von Schliff mit der Kanüle und dem Feinmuster, das aus Klöppelspitzen bestand. Es wird auch als Points d'Angleterre (englische Spitze) bezeichnet, weil es unrechtmäßig nach England geliefert wurde, wo es als nationale Handelsware angeboten wurde. Torchon: Aus der zweiten Jahreshälfte des neunzehnten Jahrhundert, zunächst eine Spitze mit einem geometrischen Motiv, die endlich in der Maschine gefertigt wurde.
Wenn sie einen größeren Bereich in der Nadeloberfläche ausfüllen, spricht man von Bahngrund.
Auf einem maschinellen Tüllboden wird mit Garnen bestickt. Die gehäkelte Spitze ähnelt den Mustern der Nadelschnürung in der Häkeltechnologie. Die Csetneker Spitze ist eine spezielle Methode der Häkelspitzenherstellung. Die Stücke mit der Abbildung werden separat verhäkelt, dann auf einem Blatt Papier oder Stoff mit der Zeichnung des Klöppelmusters angebracht und mit einem in der richtigen Lage verhäkelten Netz fixiert.
Die Occhi (ital. "Augen", auch bekannt als Frivolitätsarbeit oder Shuttle-Spitze) wird aus einem auf einem Shuttle gewickelten Garn geknotet. Die ringförmigen (die "Augen") und bogenförmigen Gestalten werden geformt und zu grösseren Gestalten zusammengefügt und bilden in der Maschentechnik Durchbrochenmuster. Für die automatische Produktion von Spitze war die Entwicklung der Strumpfstrickmaschine von William Lee in England im Jahr 1589 unerlässlich.
Die auf der Spitzenspitzenmaschine von der Maschine produzierte Spitze hat schlichte Geometrien mit überwiegend volkstümlichen Mustern. Es wird oft als "Torchonspitze" beschrieben und ist kaum von der handgemachten Spitze zu trennen. So entsteht ein durchbrochenes Gewebe, das aus der Ferne wie eine Stickerei ausfällt. Das ist die Ausstellung der Spitzen aus Wien 1906, Hrsg. von km.
Darin: Örnamentale und künstlerische Sammelmappe, Reihe IX and X, published by Karl W. Hiersemann, Leipzig 1906. Marie Schuette: Alterspitze. Nadeln und Klöppelspitze. Klinkhardt & Biermann: München, 1981; Marie Schuette: Spitze von der Wiedergeburt bis zum Kaiserreich; ein Buch für Kunstsammler und Verliebte. Der Bestand, The Collection Helmut Vieweg-Brockaus Karl W. Hiersemann: Leipzig, 1909. Schöner, Friedrich Spitz VEB Fachbuchverlag: Leipzig, 1982. Willy Erhardt: Das Glücks auf der Nadelspitze des Vogtlandes, Platuen 1995, ISBN 3-928828-13-4.
Drehbuch über den Oberkurs der Thessy Schönholzer-Nichols am TU München Lehrstuhl für Restauration, Art Technology and Conservation Science, February 2002. Höhespringen vgl. Ingrid Loschek: Reclams Mode and Kostümlexikon, Vgl. dazu auch Ingrid Loschek, Vgl. dazu Reclams Modus und Kosümlexikon, Vgl. V. Aufgefr. und Ausbau, Stuttgart 2005, Schlagwort "Spitze" (oben).