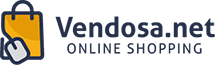Quelle Mode
Source ModeDurch die symbolische Ladung der Hosen und die damit verbundene Unterscheidungsfunktion waren zunächst besondere gesellschaftliche Regulationsprozesse für den Einsatz von Frauenhosen vonnöten. Die Wiederherstellung der Gebrauchsstandardisierung und der ästhetisch-materiellen Bekleidungsform der Damenhose lässt Aussagen über den Etablierungsgrad und die gesellschaftliche Anerkennung sowie über den Symbolgehalt des Kleidungsstücks zu.
Vorschriften und Handlungsempfehlungen für den korrekten Gebrauch von Damenhosen wurden bis in die 70er Jahre hinein gelegentlich besonders berücksichtigt. Ein wichtiger Motor für die gelungene Verankerung der Damenhose in der Mode nach 1945 ist ihr materialästhetisches Bekleidungsdesign. Durch einen femininen Schliff wurde das neue Bekleidungsstück klar von Herrenhosen und Männlichkeit unterschieden und als Damenhose eindeutig identifiziert.
Im Gegensatz zum Beispiel im Berufskleidungsbereich wurden die Hosen in der Freizeittechnik nicht unmittelbar mit ihren Männerattributen in Verbindung gebracht, sondern als speziell feminine Variation eines Kleidungsstücks gesehen. Bei der weitgehenden Vereinheitlichung der Verwendung von Damenhosen gab es vier Anforderungs- und Richtliniengruppen: Regelungen zu Anlass und Situation, Regelungen zur Kombinierbarkeit mit anderen Bekleidungsstücken und Zubehörteilen sowie Regelungen zu Körpergröße und Lebensalter der Träger.
Von besonderer Bedeutung war bis Ende der 1950er Jahre die Vorstellung und Erörterung der Vorschriften zur Ursache und Situation des Verschleißes. Doch auch als Hauskleidung, für die Anreise mit dem PKW oder Roller sowie den Besuch am Meer oder auf dem Platz wurden die Hosen als geeignete Bekleidung angesehen. Damals waren Hosen noch als Teil der Frauenmode nicht denkbar.
Das Regelwerk für die Zusammenstellung mit anderen Bekleidungsstücken und Zubehörteilen betraf vor allem Teile der Damen- und Festtagsgarderobe. Nur die flachen Schuhen waren eine geeignete Verbindung. Die Situationsbeschränkungen wie auch die Kombiverbote belegen das Bestreben, die Damenhose als primär sportliches Bekleidungsstück zu rechtfertigen, das nur in der ungezwungenen, halböffentlichen Hobbyszene zu tragen ist.
Das versperrte bis in die 60er Jahre den Einstieg in die Hosen. Besorgniserregend und empört folgte die DDR-Frauenpresse und erklärte, dass die Damenhose entgegen den heutigen Standards zunehmend auch die Freizeit-Frauenmode außerhalb des sportlich aktiven Bereichs bestimmt. Auch die Regelungen zu Gestalt und Lebensalter der Träger zu Anfang der Gründungsphase von Damenhosen zeigen eine enorme Normgültigkeit.
Auch wenn das Leitbild der schmalen Dame fortbesteht, fand Ende der 1950er Jahre die erste Lockerung der figuralen Regelungen statt. Die etwas volleren Damen durften nun unter bestimmten Bedingungen beim Hosenschnitt und der Kombinationen mit anderen Kleidern die unästhetischen Körperpartien z.B. durch verlängerte Tops abdecken.
Deshalb empfehlen Frauenmagazine und Ratgeberliteratur, dass Frauen ab 35 Jahren ihre Hosen gegen ernstere Kleidung eintauschen sollten. Die strenge Aufteilung der Mode nach Alter wurde erst in den 60er Jahren immer weniger wichtig, so dass sich auch die mit dem Tragen von Hosen verbundenen Altersbegrenzungen auflockerten. Aufgrund der umfassenden Bekleidungsvorschriften für weibliche Freizeithosen fanden die Hosen in den 1950er und 1960er Jahren zunächst nur in begrenztem Maße Einzug in die DOB.
Da die Hosen aber allmählich ihre geschlechtsspezifischen Konnotationen verlor und zu einem natürlichen Bekleidungsstück für beide Seiten wurde, verlor die mit dem Tragen von Hosen verbundene spezifische Regelung immer mehr an Bedeutung - bis die separaten Kleiderregeln endgültig obsolet wurden. Dies geht einher mit einer grundlegenden Änderung der Bedeutung der Hosen.
Am Anfang bedeutete die nachdrücklich feminine Form der lässigen Hosen, dass die traditionelle Symbolkraft der Hosen als Symbol der Maskulinität weitestgehend in den Vordergrund trat. Stattdessen wurde ihr eine spezifische weibliche Assoziation auferlegt, so dass die Hosen nicht mehr per se als Markierungen zwischen den Gendern dienten. Deren Gültigkeit als Unterscheidungsmerkmal ergibt sich nun aus der Zusammensetzung der Hosen, auf deren Grundlage die gesellschaftlichen Gruppen Maskulinität und Feminität in der alltäglichen Interaktion dargestellt und verhandelt wurden.
Die Tatsache, dass die Kleidung im Prinzip nicht mehr als Träger von Bedeutung für die männliche Erscheinung fungiert, wird auch durch den Masseneintritt der betroffenen Frauen in die Print-Werbung in den 1950er Jahren gezeigt. Auch hier wurde die enge Situationsbegrenzung der Schutzhose beibehalten. Insofern informieren die korrespondierenden Inserate über den Grad der Etablierung von Frauenhosen und deren progressive soziale Anerkennung in den 1950er Jahren.
Durch die fortschreitende Ausweitung der Frauenhosen in den 60er Jahren gingen die Zahl und die normativen Anforderungen der Vorschriften allmählich zurück. Mit dem Einzug der Hosen in die Alltagsmode im Spätherbst 1965 änderten sich neben den Anlässen und Situationen auch die Regeln für die Körpergröße und das Lebensalter des Trägers erheblich.
Andererseits hat der Anzug die ästhetische, materielle Bekleidungsform der Damenhose völlig verändert. Die eingesetzten Stoffe wie Kordel und Tweed trennten auch den Anzug von der Casual Hosen und brachten die Damenhose zurück zum Männer. Die Tatsache, dass sowohl langatmiges Reglement als auch eine speziell feminine Hosenvariante im Alltag überflüssig geworden sind, ist auf die zunehmende Reduktion oder den Wegfall der mit Hosen verbundenen traditionellen Bedeutungen und Vorstellungen von Hosen zuruckzuführen.
Die Hosen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend ihre genderspezifische Bedeutung und ausgeprägte Funktion eingebüßt. Durch den Einstieg der Damenhose in die festliche Mode um 1970 war die Hosen endlich in allen Sparten des Frauenspektrums präsent. Da" Mode in der DDR auch kein unpolitischer Raum war"[7], sind die in der DDR beschriebenen Tendenzen in der Frauenmode ohne Rücksichtnahme auf politisch-ideologische Einflüsse lückenhaft.
Die Mode manifestiert nach Ansicht der Politik der DDR nicht nur den materiellen und kulturellen Wohlstand von Staat auf der einen Seite, sondern dient zugleich "der Erbringung von kulturpolitischen und wirtschaftlichen Leistungen als Werkzeug für die weitere Entwicklung der sozialen Gesellschaft"[8] und soll "die gesellschaftliche Vormachtstellung gegenüber dem kapitalistischen Konkurrenzkampf, besonders gegenüber dem Westen Deutschlands.....", beweisen.
In diesem Sinn wurde die Einrichtung von Frauenhosen als Zeichen des wirtschaftlichen Fortschrittes gedeutet und gefördert, als Beweis für die soziale Gleichstellung der Frauen in der DDR. 1] Aufsatz über die Quelle: Mode ist kein Drang, sondern eine Genehmigung (1964). Kulturhistorische Frauenhosen, Marburg 1994 [3] Dies belegen die Resultate einer Inhaltsanalyse deutscher Frauenmagazine für den Untersuchungszeitraum 1949-1975 Sie weisen deutliche Ähnlichkeiten hinsichtlich der Verbreitung von Hosen in der DOB auf.
Dies wirkt sich neben den individuellen Etappen des Entstehungsprozesses und der materiell-ästhetischen Bekleidungsgestaltung von Damenhosen auch auf deren Standardisierung und gesellschaftlicher Anerkennung aus. Magazin für Historische Sozialwissenschaften 26 (2000), H. 4, p. 602-628, here p. 613[7] Ernst, Anna-Sabine, From clothing culture to fashion. Modus und soziale Unterscheidung in der DDR, in: Landeszentrale für politische Bildung Baden Württemberg (Ed.), Politikische Kultur in der DDR, Stuttgart 1989, pp. 158-179, here p. 158[8] Ernst, Anna-Sabine, Mode im Sozialismus. 2.
Einen' in the early GDR, in: Mänicke-Gyöngyösi, Kriztina; Rytlewski, Ralf (ed.), Lifestyle and Cultural Patterns in Socialist Societies, Cologne 1990, S. 73-94, here p. 84 [9] German Fashion Institute, Die Bedeutung der Mode in der DDR und die Aufgaben des DMI, Berlin 1962, Stadtmuseum Berlin SM 8-4, p. 2 Ernst, Anna-Sabine, Von der Bekleidungskultur zur Mode.
Modus und gesellschaftliche Unterscheidung in der DDR, in: Landeszentrale für Politische Bildung Baden Württemberg (Ed.), Political Culture in the GDR, Stuttgart 1989, pp. 158-179. Mode im Nationalsozialismus. Einen' To establish a'socialist style' in the early GDR, in: Mänicke-Gyöngyösi, Kriztina; Rytlewski, Ralf (Hgg.), Lifestyle and cultural patterns in socialist societies, Cologne 1990, pp. 73-94 Menzel, Rebecca, Jean in the GDR.
V. The deeper meaning of leisure trousers, Berlin 2004. e. V. M. Sigrid, d. h. das ist der Schlauch. Kulturhistorische Frauenhosen, Marburg 1994.