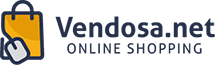Moderne Kleidung Damen
Modische Kleidung Damenmw-headline" id="USA_und_England">USA und England[Bearbeiten | < Quelltext bearbeiten]
Reformbekleidung (aus: Reformbekleidung ist der Sammelbegriff für Variationen der gängigen Damen- oder Herrenbekleidung, die ab der Hälfte des neunzehnten Jahrhundert im Rahmen der so genannten Lebensform aus Gesundheits- oder Befreiungsgründen verbreitet wurden. Mit der reformierten Kleidung für Männer soll es möglich sein, dass sich Männer freier bewegen und durch die Beseitigung von behindernden und einschränkenden Elementen am Berufsleben mitwirken.
Jahrhunderts das Korsage als extrem gesundheitsgefährdend eingestuft hatte und beispielsweise forderte, dass die Kleidung an den als widerstandsfähiger geltenden Schultern oder am gesamten Rumpf (statt an der Hüfte wie bisher) aufgehängt werden sollte. Eine der ersten Vorläuferinnen der Reformbekleidung um 1850 war das Bloomer-Kostüm, das in den USA auftauchte, eine starke Presseberichterstattung auslöste und von mehreren Frauenrechtlern getragen wurde, sich aber wegen des Widerstandes der Öffentlichkeit nicht durchsetzen konnte.
Der erste Verband der Bekleidungsreformer war die National Dress Reformvereinigung, die im Januar 1856 in Seneca Falls ins Leben gerufen wurde. In den späten 1860er Jahren war die Amerikanerin Marie M. Jones an der von ihr selbst entworfenen Hosenkostüme beteiligt; sie beschrieb die damals gängige Frauenkleidung als genderspezifische Diskriminierung.
Etwa um 1870 wurden in allen US-Bundesstaaten Verbände zur Verbreitung von "angemessener Kleidung" gegründet. Ob das zu verfolgende Reformvorhaben Frauenhosen oder nur ein verändertes Gewand waren, teilte die Organisatoren. In Deutschland wurde im Sept. 1896 auf dem International Women's Congress in Berlin zum ersten Mal das Themengebiet der Damenbekleidung in der Öffentlichkeit erörtert. Die ersten Ausstellungen fanden im Frühjahr 1897 in Berlin statt.
Nach den Erlebnissen in den USA und England war den Reformierten klar, dass die Frauenhose zu diesem Zeitpunkt nicht in der Öffentlichkeit angenommen werden würde. Pudor Heinrich, Verfasser des Buchs The Reform Clothes. Eine Mitwirkung an der philosophischen, hygienischen und ästhetischen Gestaltung des Kleidungsstücks (1903) bemängelt den Verband, dass er nicht "radikal" genug sei.
Es mag sein, dass der am Boden geöffnete Schürzenrock in gewisser Weise an die Struktur des Frauenkörpers erinnert, aber er wird den Gestalten des Menschenkörpers, der in Form einer Gabel, aber nicht in Form eines Fasses auf der Erdkugel steht, nicht annähernd gerecht", so der Autor in seinem Heft. Verstärkte Sportbegeisterung von Damen beförderte Reformbekleidung, da bodengleiche Röcke auf dem Boden und Mieder offensichtlich nicht für Radsport, Tenis oder Turnen geeignet waren.
Hosen-Kostüme für den Sport wurden daher schon vor 1900 weithin angenommen. Politisch bedingt waren die wachsende Frauengruppe, die in vielen Staaten in dieser Zeit das Wahlrecht für die Frau erzwang, und der Erste Weltkrieg, der wegen des Mangels an männlichen Arbeitskräften mehr zu einer Beschäftigung von der Frau zwang. Ab 1900 entwerfen Modedesigner wie Paul Poiret die ersten korsettlosen Kleidungsstücke.
Im Jahr 1900 wurden renommierte Persönlichkeiten wie Henry van de Velde zum Tag des Schneiders geladen, um ihre Designs für Reformbekleidung vorzustellen. Bei den ersten Modellen handelte es sich bewusst um taillenlose, d.h. taschenförmige Models ("Reform Bag"), die bei den Damen nicht sehr beliebt waren. Vor allem Anna Muthesius und Paul Schultze-Naumburg trugen neben van de Velde zu einer kunstvoll gestalteten Reformierung der Frauenkleidung bei.
In den 1910er und 1920er Jahren war Else Oppler-Legband eine der späteren Vertreterinnen der Reformbekleidung in Deutschland. Diejenigen, die sich für eine Reformierung der Frauenbekleidung aussprachen, sahen das Wohlwollen für mehr Freizügigkeit und Komfort ohne Zweifel als vorrangig an. Die Ablehnung des Korsetts erfolgte allein deshalb, weil es in seinen Blickwinkeln das charakteristische Gewand der Huren war und daher nicht von "anständigen Frauen" angezogen werden sollte.
Das Nackte wurde als eine Art Sauberkeit angesehen, während gewisse Gewänder als unreine und unmoralische Gewänder angesehen wurden. Anne-Katharina Ganzenbacher: Mieder- und Reformkleidung. Über den Wechsel in der Frauenmode von 1900 bis 1918 (PDF) Diplomandenarbeit an der Grazer Uni, Graz 2009 Anna Muthesius: Das Kleid der Römer. Carricia Ober: Die neuen Damenausstatter. Die Reformkleidung und die Bauweise des Körpers der heutigen Dame.
Schiler Verlagshaus, Berlin 2005, ISBN 3-89930-025-4 (Gleichzeitig Promotion an der Technischen Universität Berlin 2004). Die Reformkleiderin Brigitte Stamm: Das Reformgewand in Deutschland. Promotion an der Technischen Universität Berlin, Kommunikations- und Geschichtswissenschaften, Berlin 1976, Helga Stüfen: Mrs. Prof. und die Reformklamotten. Überlegungen zur theoretischen und praktischen Anwendung verbesserter Frauenbekleidung in den Jahren 1896-1905. 1997 im Eigenverlag, Berlin. 54 S. und 10 Blatt.
Reform der Kleidung um 1900. Zweite Ausgabe. Jonas, Marburg 1994, ISBN 3-89445-176-9 (Gleichzeitig Promotion an der FU Berlin 1993).