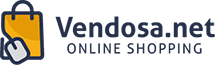Bio Lebensmittel Preise
Preise für Bio-LebensmittelRot-Grün-Prestige-Projekt Landwirtschaftliche Trendwende
Die Preise haben eine maßgebliche Signalwirkung auf dem Gesamtmarkt und spielen eine maßgebliche Rolle bei der Bestimmung des Konsumentenverhaltens. Damit die Verbraucher als Schiedsrichter auf dem Mark agieren können, müssen die Preise die Güte und die Preise eines Produkts wiedergeben. Bei den Lebensmittelpreisen wird diese Anforderung kaum erreicht. Steuerzuschüsse in Milliardenhöhe und die Verschiebung der Umweltausgaben auf die breite Öffentlichkeit führen zu verzerrten Preisen.
Es war das Bestreben, den Marktanteil des biologischen Landbaus von damals rund drei Prozentpunkten auf 20 Prozentpunkte im Jahr 2010 zu steigern. Dabei ist die Preispolitik die ausschlaggebende Faktor. Obwohl viele Konsumenten ihr Mitgefühl für Bio-Produkte bekunden, nennen knapp zwei Dritteln zu hohen Preise für Bio-Produkte als Begründung für die Zurückhaltung beim Kauf.
Schließlich hält die Haelfte der Teilnehmer zusaetzliche Preise von zehn Prozentpunkten fuer organisch annehmbar - und 40 Prozentpunkte wuerden einen Oekozuschlag von 30 Prozentpunkten ausmachen. Der Preisunterschied für Rindfleisch aus konventionellem und biologischem Anbau ist gewaltig. Das Resultat ist die Untersuchung "Was kostete ein Schnäpschen wirklich? "in der das Institute for Ecological Economy Research (IÖW) das Entstehen von offenen und versteckten Kostendeckungen in allen Produktionsschritten der Schweinefleischproduktion dokumentieren und auswertet.
Ein Kilo konventioneller Zellstoff kostet zum Studienzeitpunkt rund 7 EUR - verglichen mit 13 EUR für ein Kilo organischer Zellstoff. Es besteht kein Zweifel, dass Bio-Schweinezüchter gegenüber ihren herkömmlichen Wettbewerbern teurer sind. Damit sind die Produzentenpreise für Bioschnitzel um 60 Prozentpunkte höher als bei konventionellem Schinken. Allerdings wird der Preis des Endverbrauchers nicht nennenswert von den Ausgaben für eine andere Art der Viehzucht beeinflusst - er trägt nur wenige Cents zu dem auf dem Markt ausgewiesenen Preis bei.
Der große Preisunterschied zwischen Bio-Schwein und herkömmlichem Wildschwein im Lebensmittelmarkt ist vor allem auf den ungleichmäßigen Wettbewerb zurückzuführen. Für herkömmliche Betriebe fängt dies bereits mit einem entscheidenen Anfangsvorteil an: Die herkömmliche Fleischproduktion ist mit hohen Belastungen für die Umwelt verbunden, die die Konsumentenpreise nicht beeinflussen. Dies sind die Ausgaben für die durch Kohlendioxidemissionen (Treibhauseffekt) und die Wasserverschmutzung durch Phosphate, Nitrate und Pestizide verursachten Schaden - die von der Öffentlichkeit getragen werden.
In der Bioproduktion sind diese Ausgaben deutlich geringer, da beispielsweise keine Sprays oder mineralischen Düngemittel im Futterbau eingesetzt werden. Die Herstellung von einem Kilo Öko-Schnitzel spart im Gegensatz zur herkömmlichen Herstellung 1,5 g Pestizide, etwa die halbe Futterfläche und 40 bis 95 vH.
Wenn die Produzenten von herkömmlichem Rindfleisch die tatsächlichen Umweltausgaben (rund 45 Cents pro kg Fleisch) tragen müßten, würde sich die Abweichung der gesamten Produktionskosten gegenüber Bio-Fleisch von 83 auf 38 Cents (von 58 auf 20 Prozent) reduzieren. Anstelle von 1,43 EUR pro kg müßte der konventionelle Bauer 1,90 EUR pro kg berechnen.
Dabei sind die Umweltauswirkungen der Bioproduktion deutlich geringer: Der Biobauer müßte 2,28 EUR pro kg statt 2,26 EUR pro kg berechnen. Der große Unterschied von mehreren Euros im Einzelhandelspreis ist vor allem auf die höheren Marketingkosten für Bio-Fleisch zurückzuführen. Zum Studienzeitpunkt lag der Anteil bei nur 0,5 Prozentpunkten, also 61.000 Bio-Schweine im Vergleich zu 10,5 Mio. Mastschweinen.
Bio-Fleisch ist ein Spartenprodukt innerhalb des hochrationalisierten Produktionssystems der heutigen Schweine. Daher sind die Verteilungskosten und die damit zusammenhängenden Kosten für den getrennten Verkehr, die Tötung, das Schneiden und die nachfolgende Distribution von Bio-Fleisch an die Geschäfte verhältnismäßig hoch. Gegenüber herkömmlichem Schweine produziert ein Kilogramm Bio-Schweine bis zu 50 Prozentpunkte von "verarbeitetem Fleisch", das nicht als Bio-Fleisch verkauft werden kann.
Der Unterschied in den Einzelhandelspreisen wird dadurch verstärkt, dass nur die Feinschnitte (Schinken, Fillet, Schnitzel) von Bio-Fleisch zu Bio-Preisen verkauft werden können. Sogenanntes verarbeitetes Fleisch, zum Beispiel Magen zur Wurstherstellung, muss zum größten Teil zu den üblichen Preisen für die Wurstherstellung verkauft werden. Dies wirkt sich auf etwa die Hälfe des Kadavers aus.
Könnte das verarbeitete Fleisch neben den Kostbarkeiten auch zu Ökopreisen verkauft werden, wären Preisnachlässe für die Kostbarkeiten an der Theke möglich. Zuschläge für Kleinmengen zur Abholung, Vernichtung und weiteren Verarbeitung und die Möglichkeit, dass nur die Haelfte des Bio-Schweins als Bio-Fleisch in den Verkehr gebracht werden kann, ergeben zusaetzliche Kosten fuer die Verteilung von Bio-Fleisch in Hoehe von 4 EUR pro Kilo.
Wenn sich die tatsächlichen Ausgaben im Gesamtpreis niederschlagen würden, wäre der Abstand zwischen organisch und herkömmlich klein. Gestützt auf eine wirksame Werbe- und Kennzeichnungspolitik könnte die Umsetzung des Grundsatzes des Verursacherprinzips für die Umweltausgaben den Verkauf von Bio-Fleisch so weit anregen, dass die Verkaufsmenge ausreichen würde, um die Distributionskosten für Bio-Fleisch von (zum Zeitpunkt der Untersuchung ) 9,30 EUR pro Kilo signifikant zu senken.
So könnte man zum Beispiel mit 6 EUR pro Kilo annähernd an die Distributionskosten für herkömmliche Waren (5,30 EUR pro Kilo) herankommen und so den Öko-Schnitzel zu einem Verkaufspreis von 8,70 EUR pro Kilo ausgeben. Die Preisdifferenz am Schalter, einschließlich der Umweltausgaben, würde nur rund 1,20 EUR betragen.
Wird mehr Bio-Fleisch im Lebensmittelmarkt verkauft, kommt es zu wettbewerbsfähigen Medikamentenpreisen und höheren Umsätzen. Zum Untersuchungszeitpunkt verkaufte die Einzelhandelskette Edeka Nord ihr Markenfleisch-Programm "Gutfleisch" in herkömmlicher und biologischer Ausführung. "Auf " Großfleisch Bio " entfielen 10 Prozentpunkte des Fleischabsatzes (gegenüber 0,5 Prozentpunkten des bundesweiten Marktanteils von Bio-Fleisch).
Auch der mittelgroße Lebensmitteleinzelhändler teut meldete Vergleichszahlen. Für ein kg Bio-Schweineschnitzel in Edeka-Nord lag der Gegenpreis bei 8,50 EUR pro kg. Der Preisunterschied zum herkömmlichen Rindfleisch lag daher nur bei 1,50 EUR oder 22 vH. Anders als andere große Lebensmittelketten wurden viele Edeka-Läden von unabhängigen Händlern betrieben.
Häufig akzeptieren sie aus eigener Kraft das betriebswirtschaftliche Restrisiko des zusätzlichen Preises für Bio-Fleisch. Die laschen Anforderungen an die Fleischwerbung hindern auch Bio-Produkte daran, mehr zu verkaufen. Das Verursacherprinzip ist auch in der klassischen Landwirtschaft ein wichtiger Impuls für den vermehrten Gebrauch umweltfreundlicherer Methoden.
Der aktuelle Stand belastet diese Belastungen für die Öffentlichkeit und bringt Wettbewerbsnachteile für die ökologischen Produktion. Der durch die Verursacherprinzip bedingte kleinere Preisunterschied auf Produzentenebene wird das Anbieten und die Bedarf an qualitativ hochwertigem konventionellem und biologischem Rindfleisch deutlich steigern.