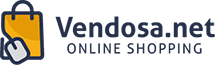Agb ́s Erstellen
Allgemeine Geschäftsbedingungen ́s ErstellenDas können Sie in den AGB regulieren.
Beim Verkauf von Waren an Endverbraucher oder Firmen sollten Sie allgemeine Bedingungen erwerben und diese in den Verkaufsvertrag aufnehmen, um von den für Sie geltenden Rechtsvorschriften abweichend zu sein. Diesen Beitrag finden Sie in der Rubrik: Finden Sie Ihr Recht heraus! In den Allgemeinen Bedingungen können Sie eine Vielzahl von Bestimmungen definieren, die alles rund um den Einkaufsvertrag regelm?
Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihre Preisangaben die Mehrwertsteuer enthalten oder nicht und wie hoch die Kosten für Verpackungen, Transporte und Transportversicherungen sind. Zahlungsmöglichkeiten: Legen Sie fest, wie der Kunde zahlen kann. Stornobedingungen: Teilen Sie Ihrem Kunde mit, wie er eine Stornierung vornehmen kann und wie sie funktioniert.
Dieser Hinweis ist für alle Fernabsatzverträge vor Vertragsabschluss notwendig. Beschränkung der Gewährleistung: Dies ist nur möglich, wenn die Warenart nichts anderes erlaubt, z.B. wenn leicht verdauliche Waren veräußert werden. Haftungsbeschränkung: Ihre Haftbarkeit kann in Einzelfällen beschränkt sein, z.B. bei einfacher und mittelschwerer Vernachlässigung oder bei Pflichtverletzung durch Hilfspersonen.
Teilen Sie Ihren Abnehmern mit, welche Verpackung und welches Altgerät unter welchen Bedingungen zurückgenommen werden kann. Die Geltung der AGB für dieses Geschäft setzt voraus, dass sie rechtsverbindlich sind. Die Art und Weise, wie dies zu tun ist, richtet sich danach, ob es sich um ein Unternehmen oder einen Konsumenten handeln soll. Für den Entrepreneur ist die Aufnahme der AGB verhältnismäßig simpel.
So genügt es zum Beispiel, wenn Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an Ihren Geschäftspartner senden und dieser ihnen nicht entgegensteht - eine explizite Zustimmung ist nicht erwünscht. Sie müssen einen Konsumenten vor Vertragsabschluss auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufmerksam machen und ihm die Möglichkeit geben, den Wortlaut der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu studieren. Vor Abschluss des Kaufvertrages muss der Konsument den Bedingungen zustimmen.
AGB: Für Selbstständige und Firmen ein Muss?
Jedes von einer Gesellschaft oder einem Selbständigen mit ihrem Auftraggeber abgeschlossene Rechtstransaktion beruht auf komplexen rechtlichen Vereinbarungen. Auch wenn ein Betrieb oder ein Vorhaben eine sehr persönliche Absprache zwischen den Beteiligten verlangt, ist es in der Regel nicht nötig, jede detaillierte Regelung zu Zahlungsbedingungen und Rechtsvorbehalt zu überarbeiten: Auch hier muss das Laufrad nicht fortwährend umgestaltet werden.
Irgendwann stellt sich daher für jedes Untenehmen die grundsätzliche Fragestellung, ob es Sinn macht, eigene AGB' (Allgemeine Geschäftsbedingungen) zu erstellen oder erstellen zu haben und Verträge mit Auftraggebern darauf aufzubauen. Jetzt ist die Gestaltung von Allgemeinen Bedingungen in der Praxis weder leicht noch günstig. Wie so oft bei solchen Fragestellungen kommt es auf den jeweiligen Fall an.
Nur die wesentlichen Vertragspunkte müssen von den Vertragsparteien festgelegt werden. Man kann sich grob vereinfachend denken, dass bereits das Recht, vor allem das BGB, eine Form von "Mustervertrag" vorgibt. Die BGB beinhaltet zunächst eine Serie von Regelungen, die grundsätzlich für alle Aufträge gültig sind. Es geht beispielsweise um die Fragen, wie Vertragsabschlüsse erfolgen und wie sie zu erfüllen sind, was im Falle eines effektiven Vertragsrücktritts passiert und ob Ansprüche abgetreten werden können.
Allerdings muss das Recht sehr umfassend sein. Vielfach werden daher wesentliche Themen nur sehr allgemeingültig oder gar nicht geregelt. Der Gesetzgeber sagt von Mühle, Schmiede und Brauerei, nicht aber von Soft- und Body-Leasing. Dies wird am Beispiel des Arbeitsvertrages kurz untersucht, wie es bei einem Projekt oft beschlossen wird.
Nahezu alle diese Aufträge haben es in sich, dass der Selbständige besonders auf die kompetente Mitarbeit des Auftraggebers angewiesen ist. Soll beispielsweise eine Software-Lösung speziell für ein bestimmtes Projekt adaptiert werden, ist dies oft undenkbar, ohne dass der Auftraggeber umfassende Information liefert, seine Ideen, Zielsetzungen und Anliegen deutlich zum Ausdruck bringt und am Gesamtprozess der Kreation beteiligt ist.
Solche Aufträge sind sehr kooperativ. Dieses Reglement gibt dem Selbständigen, dessen Auftraggeber mit einer Kooperationsleistung in Rückstand ist, das Recht auf eine entsprechende Vergütung und nach Setzung einer Frist die Rücktrittsmöglichkeit. Weitergehende individuelle Fragen werden nicht beantwortet. In Ermangelung einer entsprechenden Bestimmung sowohl in den Vertragsbestimmungen der Vertragsparteien als auch im Recht wird untersucht, was die Vertragsparteien verständlicherweise hätten vereinbaren können, wenn der ungeregelte Aspekt berücksichtigt worden wäre.
Im Zweifelsfall wird diese Interpretation jedoch von einem Richter vorgenommen, wenn es bereits einen Rechtsstreit zwischen den Beteiligten über den fraglichen Umstand gibt. Auch wenn es keine Berufung bei Gerichts- oder Schiedsgerichten gibt, ist eine geeignete Vertragsvereinbarung sinnvoll: Sie kann als "allgemeine Spielregel" dazu dienen, Missverständnissen und Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten von vornherein vorzubeugen.
Selbstverständlich ist das Recht nicht immer unvollständig, im Gegenteil, es reguliert viele der wiederkehrenden Rechtsfragen zuverlässig. Vielfach sind vom Recht abweichende Vereinbarungen aus der Perspektive einer der Vertragspartner zweckmäßig oder zumindest erwünscht. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass der Kunde oft seine eigenen Geschäftsbedingungen verwendet.
Zudem werden häufig verschiedene Einkaufsbedingungen für denselben Auftraggeber herangezogen. In diesem Fall können Ihre eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine gute Methode sein, um die Einkaufsbedingungen des Käufers "abzuschalten". Wenn beide Seiten Bedingungen und Konditionen benutzen, die sich gegenseitig ausschließen, hat keine der beiden Klauseln Vorrang und das Gesetz tritt an ihre Stelle. 2.
Abschließend kann festgestellt werden, dass in zwei Punkten auf AGB geantwortet werden kann. Einerseits, wenn Aufträge abgeschlossen werden, die mit den gesetzlich vorgeschriebenen Regeln gut "abgefangen" werden können, vor allem wenn der Kunde keine eigenen Einkaufsbedingungen verwendet. Dies kann z.B. bei reinen Einkaufsverträgen der Fall sein. Darüber hinaus sind AGB überflüssig, wenn jeder Auftrag so umfassend und kompliziert ist, dass er "von Anfang bis Ende" im Einzelnen verhandelt wird oder - wie es oft der Fall ist - wenn er nur mit Auftraggebern abgeschlossen wird, die den Vertragsentwürfen oder AGB ihres Vertragspartners nicht von vorneherein zustimmen.
Im Übrigen sollte mindestens die Schaffung und Nutzung eigener Bedingungen in Betracht gezogen werden.