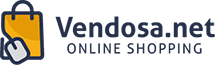Agb Onlineshop Kleinunternehmer
Der Agb Onlineshop für kleine GeschäftsleuteDer individualisierte AGB & Gesetzestext wird Ihnen dann in den Dateiformaten BMW, PDF und Text zur VerfÃ?gung gestellt. Er kann dann in Ihren Online-Shop integriert werden. Mit den Fachanwälten der Kanzlei IT-Recht werden die Gesetzestexte einer ständigen Überprüfung unterzogen und immer an die jeweils gültigen Gesetzesvorgaben und Randbedingungen angepasst.
Sollten Änderungen an Ihren verbuchten Gesetzestexten erforderlich sein, werden Sie umgehend benachrichtigt. Dadurch sind Ihre Gesetzestexte stets auf dem neuesten Stand und rechtlich absicher. Bereits seit 2004 ist es eines der Hauptthemen der IT-Kanzlei Online-Händler, warnfreie Gesetzestexte für den elektronischen Geschäftsverkehr zu erstellen und nachhaltig zu sichern. Durch unseren Rechtstextservice haben wir uns mehr als 30.000 kommerzielle Internetauftritte gesichert, so dass wir die von den Fachanwälten unserer Anwaltskanzlei ständig überwachten und gepflegten Fachtexte zu einem mehr als fairem Monatspreis anbieten können. Zugleich - ungewöhnlich - eine kurze Vertragsdauer von nur einem Mu endchen ohne verdeckte Auslagen.
Wer den Umfang und die Güte unserer AGB-Dienstleistung bis zu diesem Zeitpunkt überprüft hat, ist reif für einen rechtskonformen Online-Handel und unseren warnkonformen Online-Shop AGB für Kleinunternehmer.
Häufig gestellte Fragen zu Kleinunternehmen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Steuerrechtlich sind für Kleinunternehmer Sonderprivilegien vorgesehen, die darauf abzielen, die Steuerbelastung aufgrund der Größe des Unternehmens zu verringern, die Rechnungslegung zu vereinfach. Aber wann und unter welchen Bedingungen qualifiziert sich ein Händler als Kleinunternehmer? Inwiefern funktioniert die Kleinunternehmerregelung und welche Rechte und Verpflichtungen ergeben sich daraus?
Gibt es rechtliche Eigenheiten, die bei kleinen Unternehmen im Netz zu berücksichtigen sind (z.B. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen)? Was ist die Regelung für kleine Unternehmen? In Anlehnung an 19 des Mehrwertsteuergesetzes (UStG) ist die Kleinunternehmerverordnung eine Vereinfachungsregelung im Mehrwertsteuerrecht. Es ermöglicht Unternehmen, die bestimmte jährliche Umsatzschwellen nicht übersteigen, auf die Zahlung der Mehrwertsteuer an das Steueramt zu verzichtet und bedeutet andererseits, dass die Mehrwertsteuer von den Kunden nicht verlangt werden muss.
Müssen die Umsatzsteuern nicht erhebt werden, befreit die Verordnung dennoch diejenigen Unternehmen, die die rechtlichen Anforderungen an den Anspruch stellen, von der Verpflichtung, die Mehrwertsteuer in ihren Rechnern ausweisen zu müssen, so dass sie in Bezug auf die Mehrwertsteuer tatsächlich als "Nichtunternehmer" betrachtet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Kleinunternehmerverordnung nur Auswirkungen auf das Umsatzsteuerrecht hat. Es ist auch darauf zu verweisen, dass Kleinunternehmer im Sinne des 19 STG nicht vollständig von allen Umsatzsteuerpflichten befreit sind und sich daher nicht außerhalb des Anwendungsbereichs des Rechts bewegen sind.
In dieser Hinsicht kommt es zu einer Entwicklung der Mehrwertsteuer sehr gut, nur deren Einziehung durch das Steueramt wird aufgehoben. Was ist der Sinn der Kleinunternehmerregel? Mit der Bestimmung des 19 STG sollen Gewerbetreibende mit vergleichsweise geringem Gesamtumsatz steuerlich begünstigt und vor allem vor internen Kosten im Rahmen der Ermittlung, Erhebungen und Abführungen der Mehrwertsteuer geschützt werden.
Die Anwendung der Kleinunternehmerregel bedeutet, dass der Betreffende keine umfangreichen administrativen Buchhaltungs- und Buchhaltungsaufgaben mehr zu erledigen hat, die den Geschäftsalltag vereinfachen und eine unbehinderte Unternehmertätigkeit begünstigen. Zugleich kann die Abschaffung der Steuereinziehung Kleinunternehmern wirtschaftliche Vorzüge bringen, die sich günstig auf ihre Konkurrenzfähigkeit auswirken werden. Zugleich soll die Verordnung die Anziehungskraft des Unternehmergeistes bei potenziellen Interessengruppen durch die Aussicht auf Entlastung erhöhen und in diesem Zusammenhang auch Wettbewerbsdefizite gegenüber Großunternehmen ausgleichen.
Ab wann ist die kleine Gewerbeimmobilie verfügbar? Eine Inanspruchnahme der Kleinunternehmerverordnung ist nur möglich, wenn ein Unternehmen die unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen erfüllte. Kleinunternehmertum fehlt jedoch eine klare rechtliche Definition, so dass allgemein davon auszugehen ist, dass es sich bei einem Kleinunternehmer um einen ansässigen Kleinunternehmer handelt, der die in 19 STG festgelegten Umsatzgrenzen nicht übersteigt.
Der Anspruch auf Ausübung dieses Rechts besteht also zum einen in der umsatzsteuerlichen Stellung des Unternehmens; zum anderen sind die Anforderungen an den mengenmäßigen Umsatz zu erfüllen. Jeder (natürliche oder juristische) Mensch, der eine selbständige kaufmännische oder berufsmäßige Erwerbstätigkeit ausübt, wird nach §2 UmwStG als selbständiger Erwerbstätiger im Sinn des jeweiligen Mehrwertsteuergesetzes betrachtet. Selbständige können somit auch Selbständige im Sinn des Umwandlungsgesetzes sein.
Das Gleiche trifft auf land- und forstwirtschaftliche Unternehmen zu, vgl. §24 UStG. Hinweis: Der Begriff "Kleinunternehmer" ist keine selbständige Gesellschaftsform und seine Existenz ist nicht an eine spezifische Gesellschaftsform gebunden. Als Kleinunternehmer können auch Juristen in Gestalt von Körperschaften (UG, Gesellschaft, AG) und Partnerschaften (GbR, OG, KG) auftreten, die im aktuellen Geschäftsjahr 50.000 EUR nicht überschreiten dürften.
Schränkt die Umsatzschwelle die Dauer der Maßnahme selbst ein? Ein dauerhafter Einsatz der Maßnahme ist nur möglich, wenn der Gesamtjahresumsatz immer unter der Schwelle von EUR 16 500 liegt. Wenn im Folgejahr 500 EUR einmal über- und unterschritten werden, kann die Bestimmung des 19 STG für das dritte Jahr nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Folglich sorgen die Anforderungen der Kleinunternehmerregelung dafür, dass die Regulierung selbst mit zunehmender Geschäftstätigkeit ihrem Geltungsbereich entzogen wird. Dieses Jahr wird es in den Genuss der Maßnahme kommen können. Im Jahr 2 erhöht sich ihr jährlicher Umsatz auf EUR 16.000, so dass auch hier dem Rechtsbehelf nach 19 ZStG nichts im Weg steht.
Es ist wahr, dass X das System noch in diesem Jahr in Anspruch nehmen kann, da es nicht mehr als 50000 EUR ausmacht. Abgabenfreie Dienstleistungen, für die sowieso keine Mehrwertsteuer berechnet wird, sind ebenfalls vom Umsatz ausgeschlossen. Die vollständige Auflistung finden Sie in 4 USt-Gesetz, das als einschlägige Fallbeispiele vor allem Miet- oder Pachterträge, Dienstleistungen von Wohnungsbaugesellschaften und Versicherungsvertretern, medizinische Versorgung etc. aufführt.
Eine Ärztin oder ein Ärztin, deren Betrieb einen jährlichen Umsatz von mehr als 300.000 EUR hat, könnte daher als Kleinunternehmerin oder Kleinunternehmerin noch Waren vertreiben, sofern der Umsatz aus dieser Aktivität 17.500 EUR nicht überschreitet. Findet die Unternehmensgründung und/oder die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nur im Verlauf eines Kalenderjahrs statt, hängt das Bestehen des Status eines Kleinunternehmens zunächst nur davon ab, ob die für das Jahr der Unternehmensgründung vorgesehene Jahresumsatzerwartung unter die Marke von 17.500 EUR fällt.
Der Entrepreneur X hat nur dann ein Anrecht auf die Kleinunternehmerverordnung, wenn X für den restlichen Teil des Kalenderjahrs eine Gesamtumsatzgrenze von 11.667 nicht übersteigt. Kann sich eine Personen mit mehr als einem Wirtschaftsunternehmen auf die Kleinunternehmerregel individuell für jedes Wirtschaftsunternehmen beziehen? Dabei bezieht sich der Text des 19 USt-Gesetzes bewußt nicht auf ein konkretes Gewerk (d.h. ein Unternehmen), sondern auf die Persönlichkeit des Unter-nehmers.
Wenn also eine einzige Personen mehrere Betriebe zur gleichen Zeit führt, kann sie nur von der Regelung für kleine Betriebe als Ganzes profitieren, aber nicht für jedes Einzelunternehmen. Bei der Berechnung der Umsatzgrenzen nach 19 STG wird der absolute Gesamtumsatz eines Unternehmens, d.h. der Gesamtumsatz aus allen Bereichen, zugrunde gelegt. Die Anwendung der Kleinunternehmerverordnung entbindet die Begünstigten weder von den Anforderungen des Mehrwertsteuerrechts noch schliesst sie die Gültigkeit des Mehrwertsteuergesetzes gegenüber ihnen aus.
Es hat nur den Effekt, dass eine an sich anfallende Mehrwertsteuer nicht wirklich erhebt wird, da sie nicht zu zahlen ist. Daraus und aus der Rechtsnormung folgt nach einem Vorabentscheid des Bundesfinanzhofes (BFH, Entscheidung vom 04.04.2003 V B 7/02), dass der entsprechende Fluktuationsgrad nach §19 Abs. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. Umgekehrt ist aber auch zu dem Schluss zu kommen, dass die in 19 Umsatzsteuergesetz vorgesehenen Umsatzgrenzen nicht als umsatzsteuerfrei anzusehen sind, sondern als Brutto- aus den Nettoeinkünften einschließlich der darauf zu zahlenden rechnerischen Umsatzabgabe errechnete Spitzen.
Offenbar scheint diese rechtliche Sichtweise widersprüchlich zu sein, denn sie bewirkt, dass bei der Bestimmung des Status eines Kleinunternehmens im Umsatz, von dessen Abgabe der Entrepreneur derzeit befreit ist, eine Mehrwertsteuer in Betracht gezogen werden muss. Eine genaue logische Untersuchung der Regulierung kleiner Unternehmen zeigt jedoch, dass sie logisch ist. Der erwirtschaftete Umsatz beinhaltet ausschließlich die Mehrwertsteuer.
Würde die rechnerische Mehrwertsteuer bei der Kalkulation nicht berücksichtigt, würde die Kleinunternehmerregel selbst ihre Bedingungen aufheben. Einerseits bedeutete dies, dass auf den Umsatz keine Mehrwertsteuer zu zahlen war. Andererseits würde dieselbe Nichtzahlung oder Nichtrückforderung dem Gewerbetreibenden bei der Erfüllung der für den Anspruch auf die Beihilferegelung festgelegten Umsatzgrenzen nützen und die Schwelle für die Befreiung erhöhen, als ob die Transaktionen außerhalb der Besteuerung erzeugt worden wären.
Tatsächlich bedeutet die Verpflichtung zur Einbeziehung einer fingierten Mehrwertsteuer, dass die Umsatzgrenzen nicht vollständig ausgenutzt werden können. Würde ein Unternehmen zum Normalsatz der Mehrwertsteuer unterliegen, müßte es 19% Mehrwertsteuer angeben. Zur Ausnutzung der Mittelstandsregulierung darf der gesamte Nettoumsatz des vergangenen Kalenderjahres daher nur 14.706 EUR ausmachen.
Die Abschaffung des Rechts auf Nutzung der Kleinunternehmerregelung, d.h. die Überschreitung der Umsatzgrenzen, hat im Prinzip keine rückwirkende Wirkung. Wenn also entgegen einer seriösen Einschätzung der Umsatz sogar über der Anforderung des 19 StG liegt, bleibt die Kleinunternehmerregelung für das aktuelle Jahr gültig. Allerdings muss der betreffende Entrepreneur ab dem folgenden Jahr auf die Standardsteuer umsteigen.
Für die Ermittlung der Anforderungen nach 19 UsG ist es im Jahr der Gründung aus sachlichen Erwägungen nicht möglich, auf den Vorjahresumsatz zurückzugreifen. Der Anspruch sberechtigung liegt eine aussagekräftige Umsatzprognose zugrunde, die 17.500 ? nicht überschreiten darf. Erwirtschaftet ein Entrepreneur im Jahr der Gründung wider Erwarten einen Jahresumsatz von mehr als 17.500 EUR, behält er für dieses Jahr seinen Status als Kleinunternehmer bei.
Liegt der jährliche Umsatz im vergangenen Jahr unter 17.500 EUR, kann im aktuellen Wirtschaftsjahr die Kleinunternehmerregel für diejenigen herangezogen werden, die auf der Basis der anwendbaren Steuerbemessungsgrundlage ihren jährlichen Umsatz vernünftigerweise auf weniger als 500.000 EUR schätzen.
TEUR auf die zu Jahresanfang abgegebene Erwartung, eine faktische Überschreitung der Limite im Laufe des Geschäftsjahres löscht die Kleinunternehmerimmobilie erst zum Ende des Jahrs. Kann man von einem großen zu einem kleinen Unternehmen wechseln? Die gleichen Bedingungen nach 19 UStG sind auch hier gültig. Zeigt eine aktuelle Jahresabschluss, dass der Umsatz eines Geschäftsjahres 17.500 nicht überschritten hat, kann der ehemalige "Großunternehmer" die Kleinunternehmerregel für das folgende Jahr in Anspruch nehmen, wenn die Marke von 50.000 EUR in diesem Jahr nicht überschritten wird - auf der Grundlage einer Bewertungsvorschau zu Anfang des Jahrs.
Muss die Anwendung der Kleinunternehmerregel obligatorisch sein, wenn die Bedingungen erfüllt sind? Nein. Die Wahl der Nutzung des Systems liegt im Ermessen des Unternehmens. Er hat daher das Recht, von der Mehrwertsteuerbefreiung in Anspruch zu nehmen, 19 Abs. 2 S. 1 S. 1 UStG. Wenn der Entrepreneur jedoch trotz des Vorliegens der Vorraussetzungen auf die Wirkung des 19 STG verzichtet, ist er an diesen für 5 Vollzugsjahre und 19 Abs. 1 S. 2 STG bindet.
Inwiefern kann die Mehrwertsteuerbefreiung nach 19 STG geltend gemacht werden? Jeder Unternehmensgründer bekommt vom Steueramt zumeist nach der Unternehmensregistrierung einen Steuerfragebogen, in dem die Anwendung der Kleinunternehmerregelung ausgewählt werden kann (Zeile 7.3). Kleinunternehmer, die bereits selbständig sind, können das System weiter in Anspruch nehmen, wenn die Bedingungen für das folgende Jahr erfüllt sind.
Selbständige, die zunächst die unteren Grenzwerte überschreiten, aber in einem Jahr einen Umsatz von weniger als 17.500 EUR erwirtschaften, können die Kleinunternehmerregelung für das folgende Jahr durch formlose Antragstellung beim Steueramt geltend machen, sofern der zu erwartende jährliche Umsatz dann weniger als EUR 5.000 beträgt. Welche Vor- und Nachteile hat es, die Regel für Kleinunternehmen zu verwenden?
Eine Umsatzsteuerbefreiung im Zusammenhang mit der Nutzung der Regelung für Kleinunternehmen kann für Unternehmer in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein, insbesondere in der Gründungs- und Markteintrittsphase. Einerseits führt die Ausnahmeregelung nach 19 STG zu einer spürbaren Reduzierung des internen Verwaltungsaufwands, der im Wesentlichen darauf beruht, dass die relevanten USt-Sätze und die Betonbeträge weder richtig berechnet noch in den Fakturen angegeben werden müssen.
Ebenso ist keine Umsatzsteueridentifikationsnummer zu nennen, siehe 19 Abs. 1 S. 4 i.V.m. 14a Abs. 1, 3 und 7 UStG. Gilt diese Verpflichtung nicht für Unternehmen, wird der Rechnungslegungsprozess erheblich vereinfacht. Zusätzlich zu diesen Organisationsprivilegien bietet die Mehrwertsteuerbefreiung auch echte ökonomische Vorzüge, die sich direkt auf die Wettbewerbssituation des kleinen Unternehmers auswirken kann.
Müssen keine Umsatzsteuern berechnet oder bezahlt werden, kann der Gewerbetreibende diesen Vorzug entweder unmittelbar an seine Kunden weitergeben oder für jedes verkaufte Erzeugnis eine erhöhte Gewinnmarge erzielen. Er kann seine Artikel nach seiner Veräußerung 19% günstiger anbieten, wenn er sich an seinen Kaufpreis hält und einfach die Mehrwertsteuer abführt.
Wahlweise kann der Entrepreneur auch auf die Weiterleitung des Steuervergünstigungsvorteils und damit auf Verrechnungspreise unter Einbeziehung der Höhe der aktuell nicht erhobenen Mehrwertsteuer nachlassen. Die Anwendung der Kleinunternehmerregel muss jedoch für den Betreffenden nicht von Vorteil sein. Soweit der Kleinunternehmer keinen Anspruch auf den Vorsteuerabzug hat, kann er somit keine im Zusammenhang mit einer Kaufaktivität gegenüber dem Lieferanten gezahlte Mehrwertsteuer als negative Posten gegenüber dem Steueramt gelten lassen, 19 Abs. 1 S. 4 in Verbindung mit diesem.
15 UStG. Umsatzbesteuerte Unternehmen können die auf Kaufaktivitäten gezahlte Mehrwertsteuer von ihrem eigenen Steuerbetrag absetzen, da sie sonst mit einer Mehrwertsteuer zweimal beladen wären (nämlich sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf). Wenn jedoch für ein Produkt einmalig Mehrwertsteuer gezahlt wurde, muss dies bei der eigenen Steuerschuld des Unternehmens beachtet werden.
Dabei ist nur die Unterscheidung zwischen eigenen Steuermitteln und der Umsatzsteuer zu zahlen, d.h. die vom Entrepreneur selbst erzielte Wertschöpfung (daher der Alternativbegriff "Mehrwertsteuer"). Besteht jedoch keine Steuerpflicht nach 19 USt-Gesetz, bedeutet die Steuerbefreiung an das Steueramt auch, dass keine Vorsteuerrückerstattung gefordert werden kann.
Das Steuerprivileg kann auch dann zu einem negativen Ergebnis führen, wenn die für seine Nutzung anwendbaren Umsatzgrenzen übertroffen werden und der Status eines Kleinunternehmers aufgehoben werden muss. Zur Vermeidung von Gewinnausfällen muss der heute zu versteuernde Gewerbetreibende die Mehrwertsteuer an die Verbraucher weitergeben, die dann mit einer abrupten 19%igen Preissteigerung zu kämpfen haben, die ihre Bindung an das Unternehmen trüben könnte.
Gegenteilig können sich die negativen Effekte der Verordnung des 19 STG auf die Konkurrenzsituation auswirken, wenn sie weggelassen werden, da der dann anfallende Umsatzsteuerzuschlag von den Verbrauchern als starker Preisanstieg wahrgenommen wird und somit die Gefahr besteht, dass Verbraucher zu anderen Lieferanten wechseln. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass der Status eines Kleinunternehmens nicht unbedingt ein gutes Gründerimage auslöst.
Anmerkung: Die Vor- und Nachteile des Programms und seiner Anwendung sollten von Fall zu Fall für jeden Handel abwägt werden. Erst eine vollständige Analyse der Auswirkungen kann sicherstellen, dass der Entrepreneur die für ihn ökonomisch sinnvollere Unternehmensstrategie umsetzen kann. Muss man bei der Regulierung von Kleinunternehmen im grenzübergreifenden EU-Handel die Eigenheiten berücksichtigen?
Für die deutschen Kleinunternehmer gibt es im länderübergreifenden Güterverkehr zwei besondere Merkmale. Soweit ein Unternehmen somit nach 19 Umsatzsteuergesetz von der Mehrwertsteuer ausgenommen ist, erstreckt sich die Freistellung nur auf das Inland. Wenn jedoch der Abnehmer aus einem anderen EU-Land nach den anwendbaren einzelstaatlichen Steuergesetzen zur Zahlung der Mehrwertsteuer verpflichtet ist, ist es unerlässlich, die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Lieferanten zu verwenden.
Daher müssen kleine Unternehmer in Deutschland ungeachtet einer Ausnahmeregelung nach deutschem Recht bei grenzübergreifenden Transaktionen immer ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass nach einem richtungsweisenden Beschluss des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 26. Oktober 2010 - Rechtssache C-97/09) die europäischen Kleinunternehmer die in ihrem Herkunftsland geltenden Vorschriften für Kleinunternehmen nicht auf Transaktionen in anderen EU-Ländern anwendbar machen oder erweitern können.
Daraus folgt, dass der für die Schwellenwerte des 19 MustG relevante Gesamtumsatz nur auf der Grundlage des im Inland erzielten Umsatzes ermittelt werden darf. Dabei ist zu beurteilen, ob und inwieweit der Entrepreneur die Kleinunternehmerregelung auch in anderen Mitgliedstaaten für sich in Anspruch nehmen kann.
In Schweden, Spanien und den Niederlanden gibt es zwar keine Kleinunternehmerregelungen, in den nachfolgenden Staaten werden jedoch Steuervergünstigungen bis zu den jeweiligen Umsatzschwellen gewährt: XV. Ist die Kleinunternehmerregelung auch von der Mehrwertsteuer ausgenommen? Nein. Kleinunternehmer sind auch dazu angehalten, eine jährliche Mehrwertsteuererklärung für das vorangegangene Jahr abzugeben. Insoweit ist es richtig, dass die Mehrwertsteuer für den Betreffenden nicht aufgrund von 19 STG erlassen wird.
Zugleich wird die Mehrwertsteuererklärung des kleinen Unternehmers vom Steueramt herangezogen, um festzustellen, ob die Maßnahme noch in Anspruch genommen werden kann und um die erforderliche steuerliche Klarheit zu schaffen. Die Steuererklärungen für den Kleinunternehmer sind jedoch durch das Rechtsprivileg erheblich erleichtert und werden bei der Registrierung des zu versteuernden Jahresumsatzes der vergangenen 2 Jahre regelmässig ausgeschöpft.
Vorsicht: Kleinunternehmer sind gemäß den anwendbaren Bestimmungen zur Einreichung einer Einkommens- und Gewerbeertragsteuererklärung angehalten. Im Falle von E-Commerce-Aktivitäten hat die Anwendung der Kleinunternehmerregel eine Vielzahl von Spezifika zur Folge, die sich vor allem aus dem Zusammenwirken mit unterschiedlichen rechtlichen Informationsanforderungen ergaben. Dabei müssen Kleinunternehmer besondere Anforderungen im E-Commerce berücksichtigen. Sind Kleinunternehmer gezwungen, ihre Tarife mit "Preis inkl. MwSt." zu kennzeichnen oder nicht?
Ob kleine Unternehmen im Zusammenhang mit ihren Vertriebsaktivitäten verpflichtet sind, ihren Preisangaben einen Anhaltspunkt dafür zu geben, dass sie die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. beinhalten, ist noch nicht endgültig geklärt. Im Übrigen ist dies noch nicht der Fall. Der Streit beruht im Wesentlichen auf einem Spannungsfeld zwischen der Preisindikationsverordnung (PAngV) und 19 STG. â??Wer sich auf die Kleinunternehmerregelung des 19. STG bezieht, fÃ?r seine Umsetzungen keine Mehrwersteuer erhöht (entspricht ?mehrwertsteuerlich?), darf diese also von seinen Kunden nicht fordern und logischerweise auch nicht nachweisen.
Die von kleinen Unternehmern in Rechnung gestellten Kaufpreise sind in der Tat Summenpreise, deren Brutto-Betrag dem Netto-Betrag ausmacht. Im offensichtlichen Gegensatz zu dieser Aussage steht jedoch die Bestimmung des 1 Abs. 2 PAngV, die die Endverbraucher dazu verpflichten, anzugeben, dass alle für Dienstleistungen in Rechnung gestellten Tarife die gesetzlich vorgeschriebene MwSt. beinhalten. Im Allgemeinen wird diese Anforderung durch den erklärenden Zuschlag "Preis inkl. MwSt." oder "Preis inkl. MwSt." nach der Preiskennung berücksichtigt.
Die Formulierung des Systems soll für alle Preisindikationen verbindlich und vereinheitlicht sein. Erwähnenswert ist, dass die Mehrwertsteuer inbegriffen ist und nicht, ob sie im Einzelfall im Hinblick auf den Unternehmensstatus angegeben wird. Es ist daher fragwürdig, ob 1 Abs. 2 PAngV in der aktuellen Version auch gegenüber kleinen Unternehmern Geltung haben kann.
In den nach 19 Umsatzsteuergesetz kalkulierten Tarifen ist es falsch, "Preis inkl. MwSt." zu nennen, da diese derzeit in den Abrechnungen nicht angezeigt und berechnet werden dürfen. Selbst mit den dem PAngV zugrundeliegenden Prinzipien der Preisklärung und Preistreue ( 1 Abs. 6 PAngV) ist es schwierig, mit der Mehrwertsteuer eine Preiskomponente zu betonen, die für Kleinunternehmer eigentlich nicht vorhanden ist.
Zugleich ist der mit 2 Abs. 1 PAngV für Kleinunternehmer angestrebte Sicherungszweck von Anfang an null und nichtig. Bei kleinen Unternehmern gibt es jedoch auch ohne den Verweis "Preis inkl. MwSt." keine verdeckten Ausgaben, da die Abgabe nicht erfolgt und der Bruttpreis somit mit dem Netzpreis übereinstimmt.
Beide Lösungsansätze haben jedoch gemeinsam, dass Kleinunternehmer im Rahmen der PAngV weitere Verweise auf die steuerlichen Eigenheiten anführen müssen. a) Lösungsweg 1: Erlass des Verweises "Preis inkl. MwSt." Zum Teil wird argumentiert, dass Kleinunternehmer gezwungen sind, sich nach §1 Abs. 1 auf das Steuerrecht zu beziehen. Zwei PAngV, wenn sie sich nicht dem Verdacht einer unfairen Täuschung über ihre Preissetzung auseinandersetzen wollen (so auch das OLG Frankfurt, 07.08.2008 - Az. 6 U 219/07).
Dieser Ansicht liegt ein Verständniss des 19 USt-Gesetzes zugrunde, wonach die Mehrwertsteuer auf die Tarife des kleinen Unternehmers einfach nicht anwendbar ist, d.h. die Tarife keine Mehrwertsteuer beinhalten. Würden jedoch eine Mehrwertsteuer nachgewiesen, würde dies zu einer Irreführung der Kunden führen, die davon ausgegangen sind, dass 19% des Kaufpreises dem Unternehmen selbst nicht als Mehrwertsteuer zugutekommen.
Gewerbetreibende würden unter Bezugnahme auf die MwSt. irrtümlich davon ausgegangen, dass sie von ihrer eigenen Steuerschuld eine eigentlich nicht fällige Umsatzabgabe abziehen können. Ein reiner Erlass der Angaben "Preis inkl. MwSt." kann jedoch nicht ausreichen. Ein möglicher Lösungsansatz könnte sein: "Der angezeigte Kostenvoranschlag ist der Gesamtbetrag zuzüglich der anfallenden Transportkosten.
Nach 19 UsG wird eine Mehrwertsteuer nicht angehoben und damit auch nicht nachgewiesen (Kleinunternehmerstatus) ?Die Repräsentation durch Sternchenbezug und Bezugnahme auf das Ende der Webseite ist erlaubt (BGH, Spruch v. 04.10. 2007 - Az. I ZR 143/04). Diese Bezugnahme ist im Rahmen des Online-Geschäftsverkehrs bindend, wenn die Preisangaben klar den Erzeugnissen zugewiesen sind (Werbebanner, Artikelübersicht, Produktdetailseiten).
Gegenteilig ist immer die Forderung, dass auch Kleinunternehmer einen bindenden Verweis nach 1 Abs. 2 PAngV auf die Tatsache geben müssen, dass die Tarife die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer mitliefern. Diese basiert auf einem anderen Verständniss der Kleinunternehmerregelung des 19 UMStG und geht davon aus, dass sie nur von der Mehrwertsteuerbefreiung ausgenommen ist.
Die Freistellung kann jedoch die Herkunft der Abgabe nicht verändern, so dass die Abgabe fälschlicherweise in den Gesamtbetrag einbezogen wird und daher den üblichen Wortlaut benötigt. Die Tatsache, dass der Entrepreneur die Abgabe nicht erheben, abführen und nicht so und in seinen Abrechnungen darstellen darf, ändert nichts daran, dass die Mehrwertsteuer auch für Kleinunternehmer gilt.
Der Kleinunternehmer war daher auch nach 1 Abs. 2 PAngV dazu angehalten, der Kommission mitzuteilen, dass seine Tarife die Vorsteuer einbeziehen. Diese Sichtweise bedarf aber auch einer Erläuterung, um deutlich zu machen, dass die Steuerrechtskonstellation nicht hinter der generell üblich gewordenen Aussage steht. In diesem Zusammenhang ist auch auf den Status eines Kleinunternehmers hinzuweisen, wenn er sich gegen die Angaben "Preis inkl. Mehrwertsteuer" entscheidet.
Die Bezugnahme hier darf nicht den Wortlaut beinhalten, dass keine Umsatzsteuer erhebt wird. Es könnte leicht zu erkennen, leicht ersichtlich und nahe am Gesamtbetrag (evtl. mit einem Sternchen) formuliert werden: "Die Umsatzsteuer wird aufgrund des Kleinbetriebsstatus nach 19 USt-Gesetz nicht in der Abrechnung ausgewiesen". Zugegebenermaßen sind die Argumente, die für die Lösungsmöglichkeiten bei der Interpretation des 19 STG vorgebracht werden, Hairsplitting, was letztendlich keinen Einfluss auf die Fairness des Kleingewerbes hat.
Nur der informative Bezug zum Status des Kleinunternehmens ist entscheidend. Zwei Überlegungen machen es jedoch besser, sich für eine Regelung zu entscheiden, die auch Kleinunternehmer an den obligatorischen Bezug zur Umsatzsteuer bindet. Im Falle von Gewerbekunden des kleinen Unternehmers wäre die Angaben "Preis inkl. MwSt." daher sowieso nicht bindend und könnte unterbleiben.
Die Erfahrung zeigt auch, dass es für Kleinunternehmer günstiger ist, den obligatorischen Rechtshinweis zu übernehmen. Ohne eine solche Mitteilung wird der Kläger sie mit größerer Wahrscheinlichkeit wahrnehmen als die Nutzung der Mitteilung durch einen Kleinunternehmer, was zu Warnungen führt, die - gerechtfertigt oder ungerechtfertigt - mit einem hohen Organisations- und Zeitaufwand verbunden sein können.
Ist es notwendig, in den Allgemeinen Bedingungen auf die Regelung für Kleinunternehmen hinzuweisen? Wendet ein Kleinunternehmer die Allgemeinen Geschäftsbedinungen (AGB) an, muss er an geeigneter Stelle darauf hindeuten, dass er aufgrund von 19 EStG von der Mehrwertsteuer ausgenommen ist. Auch hier ist zu unterscheiden, ob der Verweis "Preis inkl. MwSt." herangezogen wird.
Soll auf die Regelung für Kleinunternehmen im Abdruck verwiesen werden? In §5 TMG sind die für die Lieferantenidentifikation zwingend vorgeschriebenen Daten endgültig festgelegt und stellen gerade keine steuerlichen Vergünstigungen wie den Status des Kleinunternehmers nach §19 UStG dar. Darüber hinaus hat ein Verweis auf die Kleinunternehmerverordnung den Sicherungszweck der Abdruckpflicht verfehlt, um für die Nutzer von Telekommunikationsmedien eine gewisse Offenheit hinsichtlich der Personalien der Betreiber zu erreichen und ihnen die Möglichkeit zum unmittelbaren Kontakt zu geben.
Der Status eines Kleinunternehmers ist insoweit weder Teil der Unternehmensidentität, noch öffnet er einen Kommunikationsweg zum Dienstleister. Hinweis: Im Zuge der Imprintpflicht kann der Status eines Kleinunternehmers bestenfalls dazu führen, dass auf die Angaben einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §5 Abs. 1 Nr. 6 TMG ( "TMG") zu verzichten ist, wenn diese (noch) nicht zugeordnet wurde.
Werden durch die Kleinunternehmerverordnung (andere) Informationsverpflichtungen im E-Commerce freigestellt? Nein. Die Maßnahme betrifft nur das Unternehmen des Unternehmens aus steuerlicher Sicht und berechtigt ihn bei der Einziehung und Zahlung der Mehrwertsteuer. Darüber hinaus muss ein Kleinunternehmer wie ein traditioneller Entrepreneur behandelt werden. Tipp: Sie sind ein Kleinunternehmer und wollen ohne Vorwarnung Waren über das Netz ausgeben?
Wir laden Sie ein, unseren neuen AGB-Shop für Kleinunternehmer zum Themenbereich "Kleinunternehmer und warnsichere AGBs" zu besichtigen.