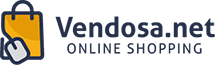Online Handel
Der Online-HandelOnline-Handel: Die 7 grössten Rechtsfälle
In der folgenden Liste sind die gängigsten in der Rechtspraxis vorkommenden Irrtümer im E-Commerce zusammengefasst und sollen ein Gefühl für die juristischen Fallstricke des Online-Handels geben. Im Online-Geschäft wird kaum eine Rechtsverletzung öfter gewarnt als das unrichtige oder lückenhafte Aufdrucken in einem Online-Shop. Welches spezifische Informationsmaterial in einem Online-Shop zur Verfügung gestellt werden muss, ist abhängig von der Art des vom Provider gewählten Unternehmens.
Der Gesetzgeber schreibt folgende Informationen für den Online-Handel vor: Die Impressumspflicht muss über einen Verweis (z.B. "Impressum" oder "Kontakt") direkt erreichbar sein und darf nicht auf der Website unterdrückt werden. Die zu verkaufenden Produkte werden im Online-Shop des Mitbewerbers so passend dargestellt oder so geschickt abgelichtet, dass man es selbst kaum besser machen könnte.
Zahlreiche Unternehmer unterliegen der Verlockung und vervielfältigen Abbildungen oder Produktbezeichnungen, um sie für ihren eigenen Online-Shop zu nutzen. Dies kann sich im Online-Handel revanchieren, denn Fotografien und Texten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit Genehmigung des Eigentümers vervielfältigt und wiederverwendet werden. Daher müssen Produktbilder, Filme und Darstellungen entweder vom Urheber selbst erstellt oder (schriftlich) genehmigt werden.
Nur dann im Online-Shop nutzen. Im Online-Handel ist der Produktpreis das wichtigste Vergleichsmerkmal. Der Online-Händler muss als Faustformel den aktuellen Schlusspreis im Online-Shop nennen, d.h. inklusive Umsatzsteuer und Versandspesen (z.B. 5,99 EUR inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten). Ausreichend ist, wenn dem Kunden vor der Auftragserteilung im Online-Shop der Gesamtbetrag inklusive aller anfallenden Kosten ersichtlich ist.
Es ist auch von Bedeutung, dass für Produkte, die im Online-Shop nach Gewichten oder Mengen angeboten werden, der so genannte Basispreis angegeben wird (z.B. 100g/ 1,99 EUR oder 1 Liter/3,50 EUR). Die Bemerkung "inkl. MwSt." wäre daher unrichtig und kann verwarnt werden. Kleine Unternehmen sollten daher darauf aufmerksam machen, dass sie keine Mehrwertsteuer berechnen und die angegebenen Verkaufspreise daher endgültige Verkaufspreise ohne Mehrwertsteuer sind.
Beim Einkauf im Netz unterliegt der Konsument dem speziellen gesetzlichen Schutze, der ihm ein 14-tägiges Widerrufsrecht gibt. Von diesem Widerrufs- und Rücksendungsrecht muss der Kunde im Online-Shop explizit in Kenntnis gesetzt werden. â??Wie die konkreten Widerrufsbelehrungen des VerkÃ?ufers im Online-Shop auszusehen haben, hÃ?ngt von unterschiedlichen Gesichtspunkten ab. Der Online-Händler muss seit 2012 eine übersichtliche und nachvollziehbare Zusammenfassung des Einkaufs und eine richtige Kennzeichnung des "Bestell-Buttons" in seinem Online-Shop haben.
In einem Onlineshop ist die Produktbeschreibung oft genauso wichtig wie der Verkaufspreis. Allerdings ist hier auch hier eine gewisse Zurückhaltung angebracht, denn auch hier gelten strikte Vorschriften für den Online-Handel. Selbstverständlich darf die Produktbeschreibung nicht täuschen. Man muss auch aufpassen, wenn man mit Konkurrenzprodukten vergleicht.
Die Gegenüberstellung muss immer auf der Grundlage objektiver Merkmale erfolgen, z.B. des Gewichts, der Inhaltsstoffe oder des Preises (unzulässig, jedoch: des Geschmacks oder der Ästhetik). Zum Beispiel ist es beim Online-Verkauf von Stoffen obligatorisch, die im Erzeugnis vorkommen. Zu guter Letzt: Kein Online-Shop sollte auf die AGB verzichtet werden.