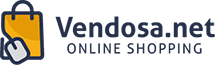Digitale Inhalte
Kundenspezifische InhalteDer digitale Inhalt kann beim Zugang zum Netz vorübergehend oder permanent geladen und auf einer physischen Harddisk abgelegt werden, und im Allgemeinen variiert der digitale Inhalt je nach Datenform. Darunter fallen zum Beispiel Akustikdaten, so genannte Audiodateien, Video-Dateien, Bilddaten, verschiedene Software wie z. B. Games und Progamme, Text-Dateien wie z. B. E-Books und verschiedene Applikationen und Applikationen.
Digitale Inhalte werden auch über das Netz verkauft. Die Anschaffung der meisten Digitalinhalte ist mit einer Zahlungspflicht des Erwerbers verbunden. Allerdings gibt es auch digitale Inhalte, die kostenfrei und unentgeltlich zur Verfuegung stehen. Man spricht von so genannten Open-Source-Inhalten.
Digital Content und Recht für digitale Inhalte und Rechtsthemen | HÄRTING Anwaltmedizinische Fakultät
Welche sind digitale Inhalte und welchen gesetzlichen Anforderungen unterstellt? Welche Aspekte muss ich als Provider von digitalem Content berücksichtigen? Antwort: Was ist "digitaler Inhalt" und was sind seine gesetzlichen Anforderungen? In § 312 f Abs. 3 BGB wurde der Terminus "digitale Inhalte" im Rahmen der so genannten Verbraucherrechtsrichtlinie (VRRL) zur Jahresmitte 2014 rechtskonform festgelegt.
Demnach sind digitale Inhalte alle "produzierten und in digitalisierter Fassung zur Verfügung gestellten Daten". Dabei ist es gleichgültig, ob der Zugriff auf diese Inhalte "durch Download oder Download in Realzeit (Streaming), von einem physischen Speichermedium oder in anderer Weise" erfolgt. Nach der geltenden Rechtssprechung des Oberlandesgerichts München (Urt. v. 30.6. 2016, Az. 6 U732/16) ist ein Abonnementvertrag für Spielfilme, Sendungen etc. auch ein Auftrag für "digitale Inhalte".
Daher erstreckt sich der Ausdruck nicht nur auf Aufträge für das Streaming oder Download von bestimmten elektronischen Dokumenten. Dazu gehören stattdessen auch Aufträge, die den einfachen Zugriff auf ein Internetportal mit (nicht spezifizierten) elektronischen Angeboten über einen größeren Zeitabschnitt ermöglichen, so dass auch bei diesen Verträgen das Widerspruchsrecht erloschen werden kann.
Der Online-Provider von elektronischen Medieninhalten - gleichgültig, ob er sie in physischer oder nicht-physischer Weise zur Verfügung stellt - muss sich grundsätzlich an die gesetzlichen Anforderungen halten, die jeder Online-Händler zu erfüllen hat. Das Online-Angebot an elektronischen Medieninhalten führt jedoch zu einer Reihe von besonderen Merkmalen, auf die wir im Anschluss noch eingehender eingehen werden: Was muss ich als Digital-Content-Provider bedenken?
Ungeachtet dessen, ob es sich bei dem Kaufangebot um digitale Inhalte oder andere Waren handele, habe der Konsument bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz ein vierzehn tägiges Rücktrittsrecht von Rechts wegen. Online-Händler müssen daher den Konsumenten nach Maßgabe der geltenden Gesetze regelmässig ein entsprechend angepasstes Rücktrittsrecht gewähren. Macht der Auftraggeber von seinem gesetzlich vorgeschriebenen Rücktrittsrecht Gebrauch, so sind alle erhaltenen Dienstleistungen zurückzusenden.
Im Einzelfall kann jedoch das Rücktrittsrecht ausgeklammert werden. Im Gegensatz zur Begriffsbestimmung digitaler Inhalte muss der Ausschluß des Rücktrittsrechts jedoch zwischen verkürzten und nicht verkürzten elektronischen Angeboten unterscheiden: Die Unternehmerin, die digitale Inhalte auf nicht-physischen Datenträgern zur Verfügung stellt, kann für diese das rechtliche Widerspruchsrecht verfallen laßen, vgl. § 356 Abs. 5 BGB.
Voraussetzung dafür ist, dass: Der Konsument erklärt sich hiermit einverstanden, dass der Entrepreneur mit der Vertragserfüllung vor dem Ende der Widerspruchsfrist anfängt, der Entrepreneur hat erst nach Rückbestätigung durch den Konsument mit der Vertragserfüllung angefangen. Eingeholt werden muss die ausdrückliche Genehmigung des Konsumenten, dass der Gewerbetreibende vor dem Verstreichen der Rücktrittsfrist mit der Erfüllung des Vertrags fortfahren kann.
Das Erfordernis der Expresszustimmung ist mit demjenigen der Expresszustimmung zur E-Mail-Werbung gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG zu vergleichen. Expressivität erfordert also reges Tätigwerden des Konsumenten und schliesst eine stillschweigende Zusage aus (BT 17/12637, S. 53). Vielmehr wird empfohlen, am Ende des Bestellvorgangs eine Bestätigungsmail des Konsumenten durch Klicken auf ein Kontrollkästchen (Opt-in) zu erhalten.
Die Vertragsdurchführung durch den Entrepreneur erfolgt in der Regelfall, sobald er den Download möglich macht (z.B. durch Zusendung des Download-Links). Dabei muss es für den Verbraucher möglich sein, den Vertragsabschluss vom Einverständnis des Konsumenten bis zum Ablauf des Widerrufsrechtes abzuhängen (vgl. Schämbacher/Creutz, ITRB 2014, 44, 46).
Dem Gewerbetreibenden muss die Erkenntnis des Konsumenten über den Wegfall des Rücktrittsrechts nachweislich nachgewiesen werden. Zu diesem Zweck ist es ratsam, sich die Kenntnisnahme zusammen mit der expliziten Einwilligung zur Durchführung des Vertrages vor Ablauf der Widerspruchsfrist bestätigt zukommen zu lasen. Natürlich darf der Dienstleister erst dann mit der Vertragsdurchführung anfangen - z.B. den Download-Link erst dann senden -, wenn die vorgenannten Bedingungen vorliegen.
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass der Lieferant den Konsumenten auch nach Vertragsabschluss explizit auf den Ausschluß aufmerksam machen muss. Rezepturbeispiel: Der Online-Händler kann sich seine Zustimmung und Wissensbestätigung durch Aktivieren eines Opt-in-Kästchens wie folgt erklären lassen: "Ich erklÃ??re mich hierfÃ??r ausdrÃ?
Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mein Rücktrittsrecht durch meine Zusage mit dem Zeitpunkt des Beginns der Vertragsdurchführung verloren habe. "Werden Inhalte auf physischen Datenträgern wie CD oder DVD zur Verfügung gestellt, verändert dies nichts an ihrer Qualität als digitale Inhalte, aber der Entrepreneur kann nicht, wie bei nicht-physischen Objekten, das Recht auf Widerruf für sie durch Zustimmungserteilung und Kenntnisnahme des Verlustes verfallen sehen.
Die entsprechenden Kontrakte sind eine gewöhnliche Belieferung mit Waren und das Recht auf Widerruf wird daher durch die allgemeinen Bestimmungen über den Widerruf von Waren geregelt. Dem Betreiber von digitalen Inhalten auf physischen Speichermedien steht die alleinige Option offen, das Recht auf Widerruf durch Aufbringen eines Siegels zu widerrufen. Nach 312g Abs. 2 Nr. 6 BGB steht ein Widerspruchsrecht bei Aufträgen über die Anlieferung von Ton- oder Videoaufzeichnungen oder Computerprogrammen in versiegelter Verpackung nicht zu, wenn das Siegel nach der Anlieferung entsiegelt worden ist.
Der Ausschluss vom Widerspruchsrecht betrifft nur Ton- oder Videoaufzeichnungen und Computerprogramme. In allen Vertragsabschlüssen im Fernabsatz ist der Gewerbetreibende dazu angehalten, dem Endverbraucher eine Vertragsbestätigung auf einem langlebigen Medium zukommen zu lassen. Das Informationsmaterial muss den Konsumenten erreichen. Die Auftragsbestätigung muss den Inhalt des Vertrages enthalten. Sie muss auch innerhalb einer vertretbaren Zeit nach Vertragsabschluss, längstens jedoch mit der Ablieferung der Waren oder vor Beginn der Leistungserbringung, stattfinden.
Nach § 246a Abs. 1 Satz 3 Satz 2 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) muss die vorvertragliche Auskunftspflicht den Vermerk beinhalten, dass das Rücktrittsrecht verfrüht verfallen kann. Es ist zu berücksichtigen, dass eine bloße Nennung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen noch nicht zum Ablauf des Widerrufsrechts, sondern zu einem konkreten Bedürfnis nach prävertraglichen Maßnahmen beiträgt. Die Bezugnahme in den AGB auf die Einhaltung der vertraglichen Auskunftspflichten lässt sich z. B. wie folgend formulieren: "Das Widerspruchsrecht verfällt bei einem Auftrag über die Bereitstellung digitaler Inhalte, wenn wir mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung mit der Vertragserfüllung fortfahren und Sie uns Ihr Wissen zugesichert haben, dass Sie Ihr Widerspruchsrecht in Hinblick auf die elektronischen Inhalte durch Ihre Einwilligung in den Vertragsbeginn einbüßen.
"Hat der Dienstleister das Recht auf Widerruf für digitale Inhalte, die nicht auf einem physischen Speichermedium gespeichert sind, mit Einwilligung des Nutzers effektiv widerrufen, so hat er dies nach dem Vertragsabschluss mitzuteilen. Sie sind dem Endverbraucher bei der Auslieferung der Waren oder bei der Erbringung der Leistung zur Verfügung zu stellen. Keines dieser Daten ist auf einen Dienstleistungsvertrag für die Beschaffung von digitalem Content abgestimmt.
Es genügt, wenn der Gewerbetreibende dem Konsumenten eine E-Mail mit den notwendigen Angaben zur Verfügung stellt. Sie haben mit Ihrer Order bis zum Anfang der Auftragserfüllung vor dem Ende der Widerspruchsfrist durch uns eine ausdrückliche Einwilligung erteilt und bestätigen, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dass Ihr Widerspruchsrecht für digitale Inhalte mit der Gewährung des Herunterladens erlischt".
Außerdem muss der Betreiber von Digital Content über das Funktionieren und die möglichen technologischen Schutzvorkehrungen informiert werden. Die Hauptaufgabe besteht darin, dem Konsumenten zu erläutern, wie die erworbenen Inhalte genutzt werden können. Die Anbieterin von Digital Content ist dazu angehalten, den Endverbraucher über erhebliche Einschränkungen der Interaktion und der Vereinbarkeit von Digital Content mit Hard- und Software aufzuklären.
Das Wiederverkaufsverbot für digitale Inhalte kann in den Allgemeinen Bedingungen effektiv festgelegt werden. Die Dachorganisation der 16 Verbraucherzentren der Länder hatte einen Hörbuch- und E-Book-Lieferanten gewarnt, der seine Waren im Online-Shop sowohl in physischer oder physischer Abwicklungsform auf Speichermedien (CD, DVD) als auch in körperfremder Abwicklungsform zum Herunterladen zur Verfügung stellt. Das Eigentumsrecht kann nur auf physische Objekte, wie z.B. DVDs, Discs, CDs, etc. übertragen werden.
Digital Content, der, wie E-Books und Audiodateien, nicht in verkürzter Form angeboten, sondern in nicht-physischer Form zum Downloaden zur Verfügung gestellt wird, ist kein physisches Objekt. Sicherlich hatte nicht zuletzt die Meldung über die technischen Kopiergeräte von digitalen Gütern sowie die gesellschaftliche Debatte über die Möglichkeit, den vermeintlichen oder faktischen Verfall der Tonträgerindustrie durch illegales Downloaden zu unterbinden, das Bewusstsein des Verbrauchers erweckt, dass er beim "Kauf" oder Downloaden von digitalen Akten nicht in der Lage sein könnte, die geladenen Inhalte in ähnlicher Weise wie ein Eigentümer zu veräußern und damit eine in jeder Belang unbegrenzte Nutzungsgenehmigung zu erwirken.
Heute ist dem informierten Verbraucher klar: Beim Herunterladen von digitalen Daten aus einem Online-Shop erhält er ein vertragsgemäßes Benutzungsrecht, nicht aber das Eigentumsrecht an der Datenmenge. Nach dieser Bestimmung dürfen Arbeiten, die mit Einwilligung des Autors in den Umlauf gelangen, ohne Einwilligung des Autors weiterveräußert oder weiterveräußert werden. Das Oberlandesgericht Hamburg erinnert darüber hinaus darauf hin, dass sich ein entsprechend verbindliches Auskunftsverbot bereits daraus ergibt, dass nicht-physische Inhalte vor der Auskunftserteilung in der Regelfall in irgendeiner Form zu vervielfältigen sind.
Das Herunterladen von digitalen Inhalten heißt nicht, dass dem Auftraggeber das Eigentumsrecht an den Inhalten oder Dateien übertragen werden sollte. Stattdessen kann der Konsument nur mit der Einräumung eines Nutzungsrechts rechnen, dessen Konkretisierung der vertragsgemäßen Übereinkunft folgt. Die Anbieterin kann in ihren AGBs die Weiterleitung der Inhalte, vor allem die Weiterleitung der Inhalte, untersagen.
Für die dem Auftraggeber zustehenden Nutzungs- und Umfangsrechte an im Netz angebotenen elektronischen Angeboten sind in der Hauptsache die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen des Dienstleisters maßgebend. Zusätzlich zu den inhaltlichen Aspekten der dem Vertragsabschluss vorausgehenden Webseiten ist daher eine sorgfältige Gestaltung des Vertrages unumgänglich. Die Betreiber von Digital Content sollten diesem Aspekt besonders große Aufmerksamkeit schenken.
Sollte die vertragsgemäße Bestimmung nicht klar, auch nicht widersprechend oder nicht zulässig sein oder wenn der Content der Webseite einen anderen Anschein vermittelt, so geht dies zu Lasten des Providers. Mit der Änderung soll den durch die Digitalmedien verursachten Änderungen des Marktumfelds Rechung getragen, für die Schaffung von Glaubwürdigkeit, die Erhaltung eines breit gefächerten Büchersortiments und die Werbung für eine große Anzahl von Vertriebsstellen gesorgt werden.
Ziel ist es, nicht nur die QualitÃ?t und VielfÃ?ltigkeit des deutschsprachigen Buchmarktes zu gewÃ? Wodurch wird sich das für die Provider wirklich ändern? Für digitale Titel, die unter 2 Abs. 1 Nr. 3 des Buchpreisbindungs- und Buchpreisbindungsgesetzes (BuchPrG) unter "Produkte, die Titel, Noten oder Grußkarten "vervielfältigen oder ersetzen", gelten bereits (zumindest nach vorherrschender Meinung) die Buchpreisbindungen.
Es ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob neue Produkte unter die Aufrechterhaltung der Preise für den Wiederverkauf stehen. Darüber hinaus ist nach vorherrschender Auffassung, dass E-Books nicht der Bücherpreisbindung unterliegen, wenn: der Zugang über wissenschaftliche Datenbestände und auf der Grundlage von Festpreisverträgen gestattet ist, nur Einzelkapitel oder Auszüge abgerufen werden können, dem Wortlaut das übliche Erscheinungsbild eines Books ( "Buch") mangelt ( "insbesondere in Ermangelung von Umschlag, Inhaltverzeichnis und dergleichen"), fremdsprachigen E-Books, sofern sie nicht mehrheitlich zum Verkauf in Deutschland vorgesehen sind.
E-Book-Verlage müssen besonders darauf achten, ob ihre Rabattpromotionen und Werbeaktionen akzeptabel sind. Schlussfolgerung: Was bringt das neue Recht für die Betreiber von E-Books mit sich?