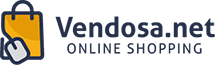B Ware Markenkleidung
S Waren Markenbekleidungmw-headline" id="Definition_der_Produktpiraterie">Definition der Produktpiraterie[Bearbeiten | < Quelltext bearbeiten]
Produkt-, Fälschungs- oder Markendiebstahl ist der Begriff, der das Unternehmen von gefälschten Waren beschreibt, die mit dem Zweck gefertigt werden, einem Originalprodukt verwirrend nahe zu kommen. Markenzeichenrechte oder wettbewerbspolitische Bestimmungen werden missachtet. Oftmals geht die Produkt- und Dienstleistungspiraterie mit einer Verletzung von Copyrights, Patent- und Gebrauchsmusterrechten (früher: Geschmacksmustern), Benutzungsmustern, Patente und anderen Rechten des intellektuellen und industriellen Eigentümers einher.
Massnahmen gegen Produkt- und Fälschungspiraterie bezeichnen den Schutz von Waren und die Produktsicherheit. Oft sind die Verpackungen und der Name der Marke identisch. Das Plagiat trägt einen leicht veränderten Namen, z.B. ein Anagramm wie McDnoald's oder visuell ähnlich wie SQNY. Teils sind diese Produktbezeichnungen sklavische Produktfälschungen und teils Produkte, die nicht vom ursprünglichen Hersteller existieren (oder so nicht).
Die Kopierkultur ist in China unter dem Namen Shanzhai (Shan Zhai) bekannt. 3 Diejenigen, die unter ihren eigenen Marken nachgeahmte Erzeugnisse anderer Produzenten verkaufen, befinden sich in einer grauen Zone zwischen Rechtmäßigkeit und Widerrecht. Es wird oft diskutiert, ob es sich um Produkt- oder Dienstleistungspiraterie oder nicht. Ein Grenzstreit zwischen Produkt- und Kunstpiraterie sind Beispiele für unbefugte Kopien von Designermöbeln wie dem Rietveld-Stuhl.
Bei der englischen Version der Produktepiraterie handelt es sich um Fälschung, der Kampf heißt Anti-Fälschung. Produktepiraterie ist in den vergangenen Jahren zu einem weltweit bekannten Thema geworden. Am Rande der EU werden jedes Jahr nahezu 100 Mio. Falschgeld- und Pirateriefälle nachgestellt. Laut EU machen Produkt- und Überproduktionen, Parallelimporte und Reimporte heute 10% des Weltmarktes für gefälschte und nachgeahmte Waren aus, was einem Verlust von über 300 Mrd. EUR auf internationaler Ebene entspricht.
Rund zwei Dritteln der Investitionsgüterhersteller in Deutschland (laut VDMA) sind vom Thema illegale Vervielfältigungen geprägt. Alleine in Deutschland gehen nach Angaben des Bundesjustizministeriums pro Jahr rund 50.000 Stellen durch Produkt- und Dienstleistungspiraterie verloren. Auch in Deutschland werden nach Angaben des Bundesjustizministeriums rund 50.000 Stellen abgebaut. Allein in Deutschland beziffert der DIHK den wirtschaftlichen Schadensumfang durch Produkt- und Markerpiraterie auf 30 Mill. im Jahr.
Darüber hinaus können Plagiate minderwertiger Qualität den guten Namen einer Handelsmarke irreparabel schädigen, wenn die Qualitätsansprüche der Kunden nicht eingehalten werden. In manchen Fällen wird Fälschung als unausweichlicher Faktor für die wirtschaftliche Entwickung solcher Staaten angesehen. Die Verordnungen (EU) Nr. 608/2013 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch den Zoll ("EU-Fälschungsverordnung 2014")[7] und die Durchführungsverordnung[8] regeln seit dem Jahr 2014 die von den Zollverwaltungen zu treffenden Vorkehrungen zur Verhinderung der Einfuhr von nachgeahmten Produkten aus Drittländern und deren Inverkehrbringen innerhalb der EU.
Gegenstände, bei denen der begründete Vorwurf von Produkt- oder Raubkopien vorliegt, können unter gewissen Bedingungen von den zuständigen Behörden sichergestellt werden. Der Beschlagnahmung ist gegen " Waren gerichtet, die im Verdacht der Verletzung bestimmter Rechte des geistigen Eigentums stehen und von denen [....] festgestellt wurde, dass sie diese Rechte verletzt haben ". Bestehen bei den Verdachtsfällen von Piraterie oder Fälschung und liegen genehmigte Beschlagnahmungsanträge vor, setzen die zuständigen Behörden die Freigabe der Waren aus oder nehmen sie zurück.
Der Rechtsinhaber muss innerhalb dieser Frist entweder gegen den Inhaber oder den Anbieter der mutmaßlichen Ware vorgehen oder ein erleichtertes Zerstörungsverfahren für die mutmaßlichen Waren einleiten. Der Zollanmelder oder Inhaber der betreffenden Waren hat dann das Recht, rechtliche Schritte gegen die von der Zollverwaltung getroffenen Massnahmen zu unternehmen. Weitere Vorschriften sind auch im Marken-, Urheber-, Geschmacksmuster- oder Pflanzenschutzgesetz zu beachten.
Auch wenn es keine klare, vereinheitlichte und eindeutig definierte Begriffsbestimmung für das Erscheinungsbild der Produktepiraterie gibt, sind sich Experten einig, dass die Produktepiraterie gewerbliche und strafrechtliche Eigentumsrechte missachtet. In Deutschland wird Produkt- oder Zeichenpiraterie mit Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren oder einer Geldbuße bestraft (§§ 106, § 107 und § 108 UrhG).
Das Strafandrohen nach 143 MarkenG vorsieht eine Gefängnisstrafe von bis zu 3 Jahren oder eine Geldbuße für eine einfache Straftat und bis zu 5 Jahren oder eine Geldbuße für Handelsgeschäfte. Die Markenstraftat ist nur im kaufmännischen Bereich zu ahnden. Die strafrechtliche Haftung nach dem Urheberrechtsgesetz und dem Markengesetz tritt in den meisten kommerziellen Verfahren jedoch in den Hintergrund.
Oftmals geht es nur um den Wertigkeit des Produkts als Statussymbole, d.h. den externen Effekt, der durch den Eigenbesitz eines Produkts einer gewissen Handelsmarke erzielt wird. Hier sind bestenfalls Massnahmen wirkungsvoll, die entweder die Steuerung der Vertriebskanäle verbessert, so dass beispielsweise der Händler überprüfen kann, ob er ein Originalprodukt hat, oder Massnahmen, die das Vervielfältigen der Ware unterbinden oder sehr zeitaufwendig und damit ökonomisch wenig attraktiv machen.
Der größte Teil der Nachahmungen wird in China hergestellt. Umsetzungsstelle ist der Bereich Customs, der unter anderem über ein "Zentrales Amt für geistiges Eigentum" in München verfügt[21] und die Datenbank für den gewerblichen Rechtschutz im Internet unterhält. 22 ] Die gewerblichen Eigentumsrechte sind hauptsächlich Warenzeichen, Gebrauchsmuster, Copyrights oder Nachfolgepatente. Nicht nur die Konsumgüter- oder Textilbranche ist von den Produktpiraten betroffen.
Dazu gehören unter anderem Dekonzentration, funktionale Integration, Qualitätscheckung, Abfalllogistik, Organisation der Lieferanten-Wertschöpfung oder die EinfÃ??hrung einer zweiten Marke. Dr. Udo Lindemann, Thomas Meiwald, Markus Petermann, Sebastian Schenkl: Wissensschutz im Wettbewerb: Gegen Produkt- und Wissenspiraterie und ungewollten Know-how-Transfer. Springer-Verlag, Berlin 2012, ISBN 978-3-642-28514-1 Thomas Meiwald: Schutzkonzepte gegen Produkt- und Markenpiraterie und ungewollten Know-how-Abfluss. Dr. Hut Verlag, München 2011, ISBN 978-3-8439-0167-3 Michael Stephan, Martin J. Schneider: Marken- und Produktepiraterie.
Fälschungsstrategien, Schutzgeräte, Kampfmanagement, Symbolverlag, Düsseldorf 2011, ISBN 978-3-939707-69-1 Schnapauff, Kai: Vorbeugender Fälschungsschutz für technische Produkte. 2010, TCW Verlagshaus, ISBN 978-3-941967-01-4 Marcus von Welser, Alexander González, Fälschung und Piraterie, Konzepte und Lösungen zu ihrer Bekämpfung. aus. 2007, Wiley-VCH, ISBN 3-527-50239-4 Christoph Wiard Neemann: Methode zum Schutze vor Produktnachahmungen.
2007, Shacker Verlags, ISBN 978-3-8322-6271-6 Thomas Meiwald, Markus Petermann, Udo Lindemann: Entwicklung eines Schutzkonzeptes zur Verhinderung von Banknotenpiraterie. 2008, in der Abteilung Industriemanagement, N. Gronau, H. Krallmann, B. Scholz-Reiter, GITO GmbH Publishing House for Industrial Information Technology and Organization, Berlin, ISSN 1434-1980. Rainer Erd, Michael Rebstock: Product and brand piracy in China.
Shacker Verlagshaus, Aachen 2010 ISBN 978-3-8322-8996-6 Jörg Kammerer, Xiaoli Ma, Ina Melanie Rehn, Hans-Joachim Fuchs: Piraterie, Fälschung und Kopierer: Effektive Verfahren und Richtlinien gegen die Schutzrechtsverletzung in China. 2006, Gabler Verlags, ISBN 978-3-8349-0159-0. 2008, in Selbstoptimierende Mechatronische Systeme: Design the Future, J. Gausemeier, F. Rammig, W. Schäfer, W. V. Westfalia Druck in Paderborn ISBN 978-3-939350-42-2 Ingo Winkler, Wang XueLi: Made in China - Brands and Product Piracy.
2007, IKO-Verlag Frankfurt, ISBN 978-3-88939-893-2.[15] - Texten von Hochschulen und Beratungsfirmen, sowie aus dem PDF-Magazin "Asien Kurier" über Produkt- und Markenpiraterie, Dokumenten und Anschriften / Websites in Deutschland und China. Highspringen Reinhard Scholzen: Marken- und Produktpiraterie: Ein Kriminalitätsbereich mit enorm hohen Zuwachsraten. Zurückgeholt am 08. 07. 2014. Hochsprung Neue Akzente im Einsatz gegen Produkt- und Markerpiraterie| Karg und Peterssen - Anti-Piracy-Analystin.